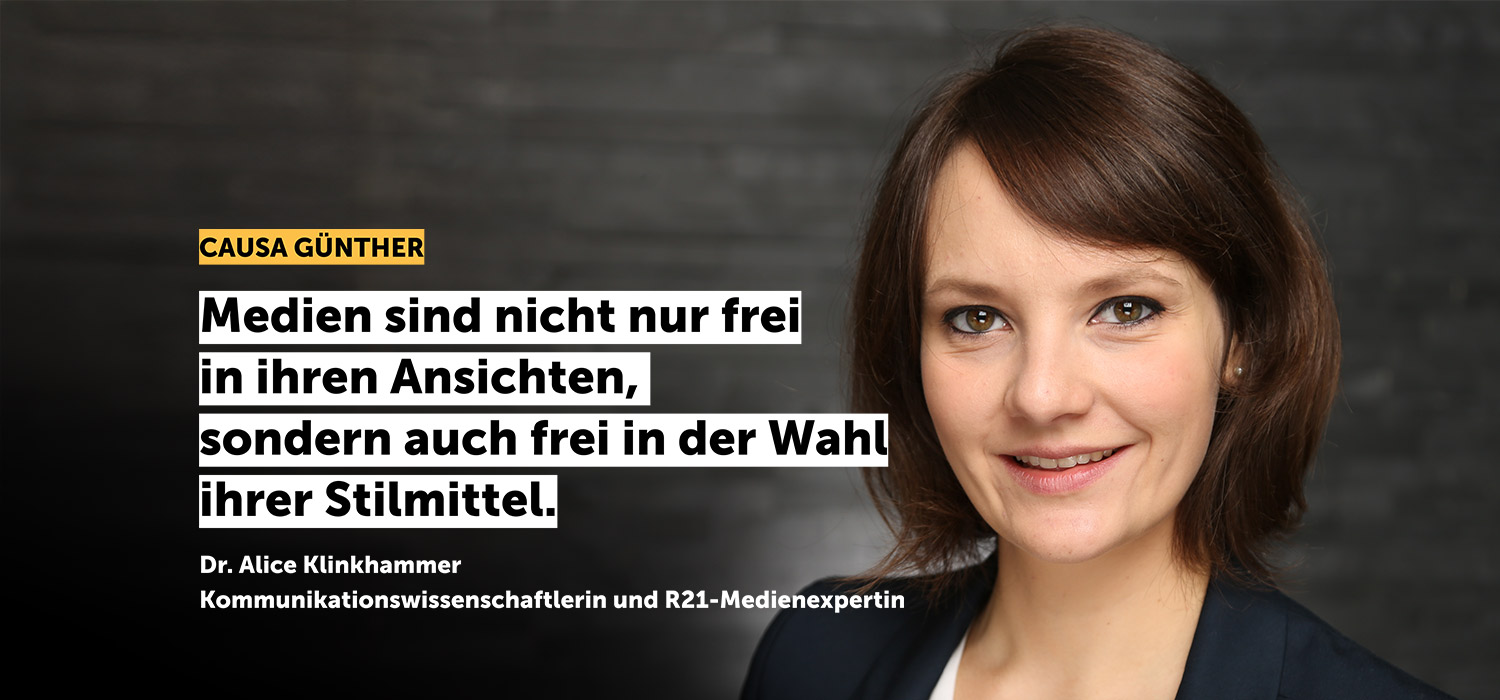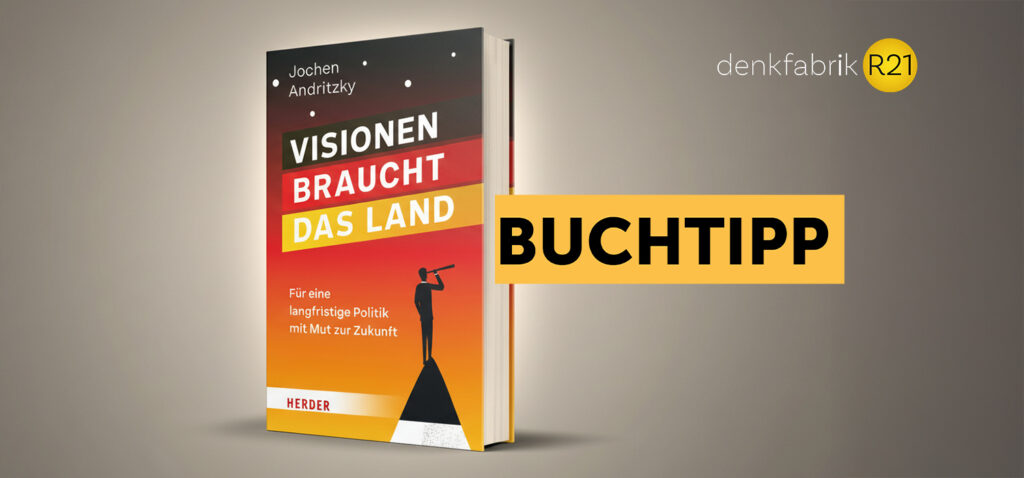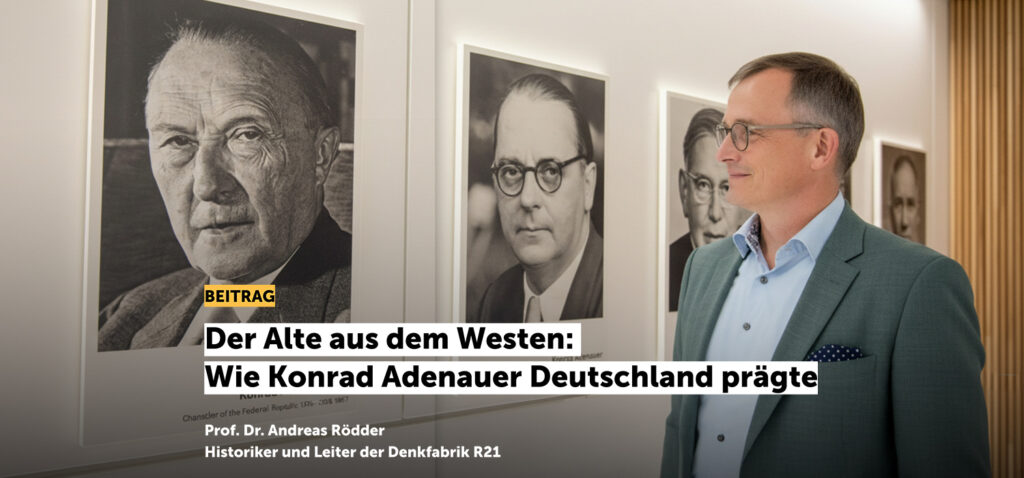Nie wurde das Aussehen eines Politikers so verhöhnt wie das von Donald Trump. Der Tenor, nie endend, immer weiter dröhnend bis zum Überdruss: Trump der Dicke, der Orange, der mit den peinlich blond gefärbten Haaren, der bodenlangen Krawatte, den kleinen Händen, dem plumpen Goldbrokatgeschmack. Wie hässlich aufgeworfen seine Häuser sind, sein Leben, sein Gang, seine Gesten, wie hässlich sein Essen ist, immer Burger, immer Fett. Die Frauen in Trumps Umfeld – ob es sich um seine Töchter handelt, seine erste Frau Ivana, mehr aber noch seine dritte Ehefrau Melania Trump, seine Schwiegertöchter oder MAGA-Frauen in politischen Ämtern – werden verlacht, als dem Oberchauvinisten Trump unterworfene Patriarchatssklavinnen ausgewiesen, von (linksprogressiven) Frauenzeitschriften wie «Vogue» oder «Harper’s Bazaar», die gerne alle möglichen Frauen interviewen, lange nicht nur Models, Autorinnen oder Stars, sondern auch Präsidentengattinen oder Politikerinnen, geschnitten oder verrissen.
Dennoch hat die MAGA-Bewegung eine spezifische Schönheit, einen spezifischen Stil der Frauen hervorgebracht, die Trump nahestehen. Sachte überspitzt beschrieben: die Haare hart geföhnt (im Gegensatz zur bauschigen Hillary-Clinton-Frisur) und dennoch in langen Wellen fallend, hart geschminkt, mit harten Waden, harten Heels, hart manikürten Händen, glatten und schlanken Silhouetten, glänzendem Schmuck und engen Kleidern.
Und MAGA hat auch ein Gesicht geschaffen, das inzwischen sogar einen Wikipedia-Eintrag hat. Das «Mar-a-Lago Face», benannt nach Trumps Anwesen in Florida, ist ein betont schönheitsoperierter Look von Frauen um Trump, dazu gehören insbesondere Melania Trump, Lara Trump (Schwiegertochter), die US-Botschafterin in Griechenland Kimberly Guilfoyle, die Heimatsschutzministerin Kristi Noem, die MAGA-Influencerinnen Laura Loomer oder Melissa Rein Lively. Das «Mar-a-Lago Face» ist die Visualisierung einer politischen Zugehörigkeit republikanischer Frauen, die derzeit Spitzenpolitik betreiben – sie kopieren und überbetonen, zumindest scheint es so, die wesentlichen Gesichtszüge von Melania Trump, und betonen damit ihre Loyalität zum Präsidenten, bei gleichzeitiger Einforderung der Anerkennung ihrer Leistungen: übervoll gespritzte Lippen, mit Fillern stark unterlegte Wangenknochen, kleine Nasen, faltenfreie und gebräunte Haut, ausgeprägte, manchmal vermutlich tätowierte Augenbrauen, künstlich, überlange und dichte Wimpern, Lipgloss und nochmal Lipgloss, insgesamt starkes Makeup, übermäßig gebleichte Zähne, weißer als die Tasse, aus der dann getrunken wird. Es sind Gesichter, die bewusst künstlich wirken sollen.
«A lot of us who support President Trump want to look our best», sagte die selbst genauso schönheitsoperierte Unternehmerin Amanda Till in einem Interview mit der «New York Post». Die «Trumpifizierung» der Frauengesichter wird vorhersehbar von linksprogressiven Medien verhöhnt (rechtkonservative Medien wie Fox News lassen sie unkommentiert, die rechten Frauenmagazine «Evie» und «The Conservateur» finden sie schön): soldatisch ausgerichtete Faschistenästhetik, skandieren linke Beauty-Influencerinnen. Der uniforme, klonartige Look der MAGA-Frauen sei Tribalismus, schreibt die spanische «El Pais»: «In der polarisierten amerikanischen Gesellschaft leben wir in Blasen mit einem ausgeprägten Stammescharakter. Wenn die Anführer einen künstlichen Look haben, dann werden die Anhänger diesen nachahmen, weil sie nur Menschen wie sich selbst sehen.» Die Zeitschrift Mother Jones sieht in der visuellen Konformität der Führungskaste der MAGA-Frauen Zeichen ihrer «physischen Unterwerfung» unter Trump. Das «Mar-a-Lago-Gesicht» brauche nur ein aus einem einzigen Menschen bestehendes Publikum: Trump, heisst es woanders, sei aggressiv, grotesk, affig, fratzig, ironischerweise Dragqueen-haft, und das bei nazihaften Frauen, die alles queere verabscheuen.
So what, möchte man entgegnen. Faktoren wie Herkunft, Wertekonformität und auch Geld schaffen nunmal Zugehörigkeit und diese wiederum generieren spezifische Äußerlichkeiten. Auf eine Art ist das alles also weder neu, noch MAGA-Frauen vorbehalten. First Ladies kreieren Moden, denken wir an Jackie-O.-Sonnenbrillen oder Perlenketten, oder an Michelle Obamas Jason Wu Kleider. Wenn Kritiker nun höhnen, MAGA-Frauen mögen es grotesk, in Hollywood aber bevorzuge man den «natürlichen» Filler-Botox-Look, mag das für Gwyneth Paltrow gelten, sicherlich aber nicht für Meg Ryan, Sandra Bullock oder Nicole Kidman. Wenn Kritiker höhnen, MAGA stelle Distinktion und auch Wohlstand auf vulgäre Weise zur Schau, quasi mit baumelndem Preisschild (Filler seien teuer, derartig viele Filler erst recht, ausserdem blinkten die Kleider zu sehr, Schmuck, Schminke seien zu schrill), dann ist auch das nicht nur MAGA vorbehalten: Als wären die Preise bestimmter Schlabberlooks, oder veganen Faserkleidern in Papiertütenform weniger ersichtlich.
Die Darstellung der Glaubensgrundsätze und des Reichtums bestimmter elitärer Klassen waren stets an Repräsentationsroutinen gebunden, ob es sich dabei um das Aussehen im Sinne von Schminke und Haarfrisur, oder um bestimmte Räume und Objekte handelte: Auf der Ikonenmalerei des Mittelalters war Kobaltblau die kostbarste und daher den Gewändern der Heiligen vorbehaltene Farbe, der Sonnenkönig trug ptachtvolle Perücken und stellte sich in den kostbaren Gärten von Versailles dar, Photographien des reichen Bürgertums im 19. Jahrhundert zeigen dunkle Kleidung, saubere Gesichter, Teppiche, Tapeten und Gemälde als Distinktionsmerkmale.
Die Kritik hat dennoch einen wahren Kern: das «Mar-a-Lago-Gesicht» ist Ausdruck einer spezifisch weiblichen politischen Identität, um nicht zu sagen, Loyalität, es ästhetisiert die Politik, oder politisiert die Ästhetik, wie man es nimmt. Als Vorgängerin republikanischer Weiblichkeit als auf Körperoberflächen ästhetisierte Pantomimen politischen Spiels kann die ehemalige Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin gelten, allerdings noch dezent. Die «Ma-a-Lago»-Gesichter von heute sind in der Tat übertrieben aufgeplustert, erkennbar künstlich. Zusammen mit den beeindruckenden, langen Haaren sind sie dennoch attraktiv und kraftvoll, wirken durch die vielen Filler, die die Mimik verhärten, genauso, wie sie wirken sollen, panzerhaft, undurchdringlich, nichts verratend – insbesondere in einem politischen Klima des Hasses und der Spaltung, in dem mit das grösste Hassobjekt die schöne, schlanke rechtskonservative Frau ist, wie schon die Radikalfeministin Andrea Dworkin vor Jahrzehnten anerkannte. Alle Frauen werden unterdrückt, sagte die extrem linke Dworkin, rechte wie linke, sie richten sich nur jeweils anders ein. Linke Frauen, so Dworkin, träumten naiv von der Revolution, rechte, egal welcher sozialen Schicht, betrieben den bestmöglichen Kuhhandel mit dem Patriarchat, machten aus Not und Erniedrigung eine Tugend und richteten sich derartig im Sexismus ein, dass innerhalt ihrer patriarchalen Entwertung eine Form der Wertschätzung entstehen könne. Für das «Mar-a-Lago-Gesicht» würde Dworkin daher feststellen: Sie sind loyale Anhängerinnen, ziehen sich an, statten sich aus, wie ihr Umfeld es gebietet oder mag, bekommen Status und Respekt, überleben.
Die Frauen sähen alle wie Mitglieder der Trump-Familie aus, sagte der republikanische Kommunikationsberater Ron Bonjean. Vielleicht wie Cousinen.
Author
-

Sarah Pines ist im Sauerland und in Bonn aufgewachsen, hat Literaturwissenschaft in Köln und an der Stanford University studiert und wurde in Düsseldorf mit einer Arbeit über Baudelaire promoviert. Sie schreibt für die Kulturressorts der ›Zeit‹, der ›Welt‹ und der ›NZZ‹. Pines lebt als freie Autorin in New York. 2020 veröffentlichte sie die Kurzgeschichtensammlung ›Damenbart‹; im August 2024 erscheint ihr erster Roman ›Der Drahtzieher‹.
Alle Beiträge ansehen