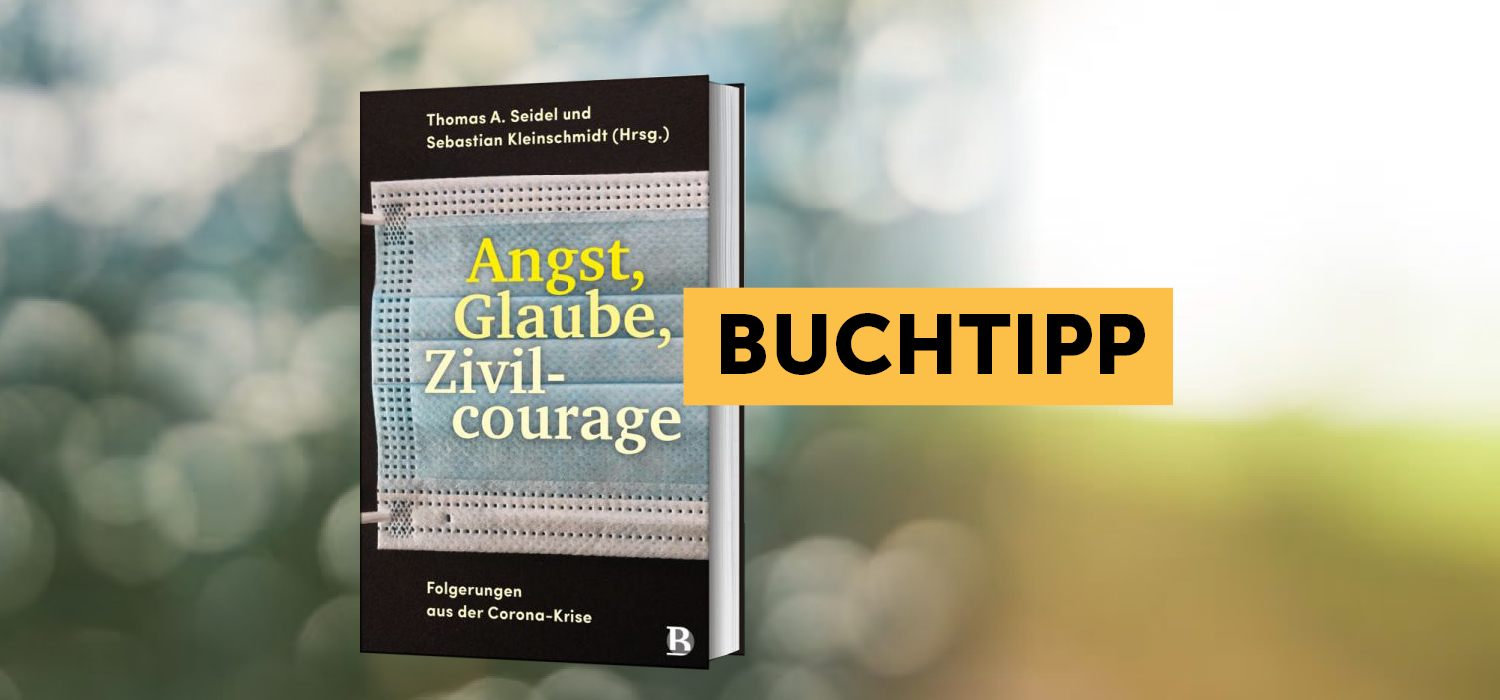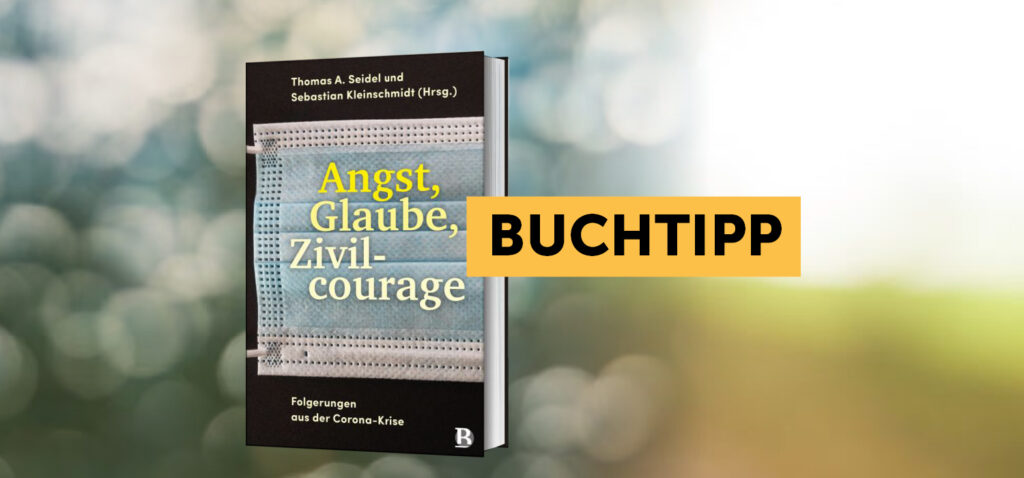Neue bürgerliche Gesellschaftspolitik statt neuständischer Staatsinterventionismus
„Ungleichheit“ ist zu einem Schreckgespenst der öffentlichen Diskussion geworden. Bis weit in die Union hinein gilt „Ungleichheit“ inzwischen als Synonym für „Ungerechtigkeit“, obwohl die Unterschiedlichkeit der Menschen eine lebensweltliche Selbstverständlichkeit und elementarer Bestandteil des christlichen Menschenbildes ist. Seit vielen Jahren kommt als Gegenmittel die „Gleichstellung“ zur Anwendung. Sie geht von Gruppen aus, nicht von Individuen, und sie zielt auf Ergebnisse: die Verteilung von Positionen, Ämtern oder Gütern nach Quoten und Proporz. Ohne es wohl zu wollen oder zu reflektieren, zielt Gleichstellung auf eine neue ständische Gesellschaft.
Erfolgsrezept der Moderne: Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft
Die ständische Gesellschaft war die Organisationsform der Vormoderne. Im 19. Jahrhundert wurde sie von der bürgerlichen Gesellschaft abgelöst, die ein anderes Versprechen mit sich brachte: Nicht länger sollten Herkunft oder Gruppenzugehörigkeit für die soziale Position der Menschen entscheidend sein, sondern ihre individuelle Leistung und ihre freie Entscheidung, und vor allem: Bildung und Beruf. So entstand die Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft, die erst die Dynamik, den Erfindungsreichtum und den Wohlstand moderner Gesellschaften möglich machte. Gerechtigkeit sah diese bürgerliche Gesellschaft nicht in der Repräsentation von Gruppen, sondern in den Chancen für Individuen, ihre eigene Talente zu entfalten und zur Geltung zu bringen.
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ lautete diese Vision in der US-amerikanischen Zuspitzung – und zeigte zugleich Zweierlei: Der individuelle Erfolg, der den sozialen Unterschied macht, wird gewollt. Und zugleich ist die Vision immer ein Ideal, das sich nie vollständig umsetzen lässt und in seiner Realität immer wieder hinterfragt werden muss. In den USA des 21. Jahrhunderts wird soziale Position in hohem Maße vererbt, indem Mittelschichtenfamilien ihre Kinder auf die Elitehochschulen schicken, die Karrieren vorzeichnen. Und auch in Deutschland hängt Bildungserfolg in deutlich höherem Maße von der sozialen Herkunft ab, als das dem bürgergesellschaftlichen Ideal lieb sein kann.
Verzerrte Wahrnehmungen, statistische Fallen und tatsächliche Blindstellen
Bevor dies zu pauschal beklagt wird, ist allerdings zu bedenken, dass Deutschland dabei Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist. Die Bildungsreformen der Sechziger und Siebziger in Westdeutschland folgten dem Versprechen vom Aufstieg durch Bildung.
Das Konzept war, Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, und dazu wurden vor Ort höhere Schulen gebaut und zugänglich gemacht. Der Sozialaufstieg durch Bildung wurde zu einem Generationenprojekt von jungen Menschen, die als erste ihrer Familie Abitur machten, studierten und in gutbezahlte gesellschaftliche Positionen aufrückten. Die Bildungsreformen und die damit verbundene Verbreiterung der Mittelschichten wurden zu der Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik. Damit geriet die Gesellschaft zugleich in eine sozialstatistische Falle: Die Tochter eines Universitätsprofessors, der aus nichtakademischen Verhältnissen stammt und damit seinen Sozialaufstieg geschafft hat, kann ihrerseits sozial gar nicht mehr aufsteigen, weil eine Professur als Bildungskategorie an der Spitze der sozialstatistischen Pyramide steht. Die Tochter kann also viel klüger, erfolgreicher und berühmter werden als ihr Vater – sozialstatistisch wird sie höchstens als Seitwärtsbewegung bzw. als ausgebliebener Sozialaufstieg geführt.
Abgesehen von den paradoxen sozialstatistischen Folgen hatten die Bildungsreformen allerdings auch ihre handfesten Blindstellen: Sie richteten sich – seinerzeit sprichwörtlich – an das katholische Mädchen aus der Eifel, das die Chancen nutzte, die das neu gebaute Gymnasium eröffnete. Profitiert haben von den Bildungsreformen vor allem die deutschen Mittelschichten und hier insbesondere die Mädchen – sehr viel weniger hingegen Unterschichten und Migranten. Sie haben die Bildungsreformen sehr viel weniger erreicht.
Dort bestehen vielmehr weithin Barrieren fort, die Angehörige der Mittelschichten gar nicht wahrnehmen: Mittelschichten zeigen ihren Kindern unterschiedliche Studienorte, können sie beraten und kennen die Tricks und Kniffe, wie man sich um Stipendien bewirbt. Nichtakademische Familien haben oftmals kein Geld, um sich verschiedene Studienorte anzusehen, sie wissen nichts über Stipendienmöglichkeiten, und wenn das Bafög verspätet bewilligt wird, ist das ein Existenzproblem für ein Studium. Abgesehen davon gibt es natürlich auch die vererbten Hartz-IV-Biographien und verfestigte kulturelle Barrieren gegenüber Bildung und Leistung, aus denen Kinder kaum herauskommen können – zumal wenn sie die entsprechenden Vornamen tragen und mit der entsprechenden Sozialisierung in die Schule gehen.
Formale und reale Chancen
Zwar kann man heute völlig zu Recht sagen: die formalen Chancen, Abitur zu machen, sind für alle so groß wie noch. Aber: es sind formale Chancen, die Amartya Sen von realen Chancen unterscheidet. Gemeint sind damit Chancen, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern tatsächlich erreichbar sind. Es sind diese realen Chancen, die in unterprivilegierten Milieus fehlen. Und genau hier muss eine neue bürgerliche Politik ansetzen: mit einer Offensive, um Startchancen zu verbessern. Auch diese Vision wird ein Ideal bleiben. Die Ungleichheit der Startchancen wird sich nie ganz verhindern und nivellieren lassen. Dass das Professorenkind am Familientisch mit Bildungsinhalten aufwächst, ließe sich nur durch ein Modell verhindern, das Kinder frühzeitig und vollständig ihren Eltern entzieht. Überflüssig zu sagen, dass solch totalitäre Modelle nicht einmal in totalitären Systemen funktioniert haben.
Die bürgerliche Alternative ist die Offensive für „echte Chancen“. Sie beginnt mit der nötigen Sensibilität für niedrigschwellige Barrieren, die akademische Mittelschichten (und damit: die öffentlichen und politischen Eliten) allzu schnell übersehen. Und sie startet eine Offensive, um verfestigte Benachteiligungen aufzubrechen und gerechtere Chancen zu eröffnen.
Eine neue Chancenoffensive
Dabei können es nicht mehr die Rezepte der Bildungsreformen vor 50 Jahren und das Vertrauen auf das Eigenengagement des katholischen Mädchens aus der Eifel sein – nötig ist vielmehr ein proaktives staatliches Empowerment. Eine solche Chancenpolitik bezieht die Familien mit ein und setzt auf Paten und Mentoren, seien es Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, seien es besser noch Migranten, die ihre Chancen selbst aktiv genutzt haben und die als Vorbilder dienen können. Eine vorbildliche Einrichtung ist das „Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt, das inzwischen bundesweit an verschiedenen Standorten angeboten wird: ein Bildungsstipendium mit Programmangeboten, das Kindern und Eltern dabei hilft, Zugangsbarrieren zu überwinden.
Zwei Migrantenkinder wollen zum Beispiel selbst Lehrer werden und somit ihre eigenen Erfahrungen und ihren eigenen Erfolg weitergeben – das ist ein Rezept, um Sozialaufstieg durch Bildung zu einem Rollenmodell bei denjenigen machen zu können, denen dieses Prinzip bislang fern geblieben ist. Solches Engagement darf der Staat aber nicht allein zivilgesellschaftlichen Organisationen überlassen. Bei der Schaffung von Voraussetzungen ist tatsächlich mehr Staat nötig. Und wenn dann Voraussetzungen echter Chancen geschaffen sind, dann greift das Prinzip der Selbstverantwortung – und der unterschiedlichen Ergebnisse. Ungleichheit auf der Grundlage gleicher Chancen als Ergebnis unterschiedlicher Leistungen, individueller Präferenzen und freier Entscheidungen ist in der liberalen Gesellschaft gern gesehen – nicht die Erfüllung staatlich vorgegebener und quotierter Erwartungshaltungen!
Dieses Prinzip gilt auch in der Geschlechterpolitik. Die Benachteiligung von Frauen ist zu einem verfestigten Narrativ geworden, von der „gläsernen Decke“ über „verkrustete Rollenbilder“ bis zum „gender pay gap“. Es ist mit zunehmenden Gleichstellungsmaßnahmen und dem beruflichen Aufstieg von immer mehr Frauen in Führungspositionen sogar eher noch stärker geworden – und bekräftigt das von Alexis de Tocqueville schon 1835 erkannte Paradox, dass mit dem Abbau von Ungleichheiten die Sensibilität gegenüber verbliebenen Ungleichheiten zunimmt.
Die Tücken der Geschlechtergerechtigkeit
So wird inzwischen die Parität, also die 50%ige Vertretung von Frauen gefordert, zum Beispiel in Parlamenten bzw. auf den Landeslisten, die von den Parteien erstellt werden. Was aber wäre ein gerechter Maßstab: der Anteil von Frauen an der Bevölkerung – oder ihr Anteil an der Mitgliederschaft, weil der Eintritt in eine Partei der freien Entscheidung und keiner Diskriminierung unterliegt? Können 26,5 % der Mitglieder aufgrund ihres 50%igen Anteils an der Bevölkerung die Hälfte der Listenplätze beanspruchen? Und sollte es nicht der mündige Bürger sein, der entscheidet, welche sozialen Gruppen in unseren Parlamenten wie vertreten sind? Die Gerechtigkeitsfrage ist nicht so einfach, wie es pauschale Formeln der „Parität“ erscheinen lassen.
Das gilt auch für den sogenannten gender pay gap. Zum einen enthalten die statistischen Gesamtgrößen nicht nur Verzerrungen aufgrund von Branchen, Unternehmensgrößen und geleisteten Überstunden, sondern vor allem aufgrund unterschiedlicher biographischer Entscheidungen: 84 % beträgt derzeit der Männeranteil beim Studium der Elektro- und Informationstechnik, 77 % der Studenten der Germanistik sind Frauen. Rund um die Geburt eines Kindes neigen Frauen nach wie vor deutlich häufiger als Männer dazu, ihre Berufstätigkeit zu reduzieren oder zeitweise aufzugeben. Solange erwachsene Menschen mit freien Entscheidungen unter Abwägung aller Vor- und Nachteile ihr Konzept eines guten Lebens leben, können wir daran nichts Falsches erkennen.
Ungleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeit hingegen ist inakzeptabel – und gibt es daher zum Beispiel im Öffentlichen Dienst auch nicht. Allerdings gibt es eine Ausnahme: mit zunehmender Dienstzeit steigt man in den Erfahrungsstufen auf und verdient für die gleiche Tätigkeit mehr – ist dieser pay gap zwischen Dienstälteren und -jüngeren legitim oder illegitim? Und was ist mit frei verhandelbaren Verträgen: wenn ein Chefarzt ein höheres Gehalt aushandelt als eine Chefärztin – ist das eine strukturelle Benachteiligung im Sinne des gender pay gap? Oder ist es mangelndes Verhandlungsgeschick, das aber keiner staatlichen Regulierung bedarf?
Und was ist mit den neuen Ungerechtigkeiten, die durch Quoten erzeugt werden – diesmal von Seiten des Staates? Die Frauenquote für Unternehmensvorstände kann dazu führen, dass eine kinderlose Unternehmertochter aus München-Bogenhausen den Vorzug vor einem vierfachen Familienvater mit Migrationshintergrund aus Berlin-Neukölln erhält. Ist es gerecht, wenn ein junger Mann als Mitglied eines Geschlechterkollektivs für Vorteile in Haftung genommen wird, die andere Mitglieder dieses Kollektivs tatsächlich oder vermeintlich hatten? Wenn Professuren eigens für Frauen ausgeschrieben werden, widerspricht dies sowohl dem Prinzip der Individualgerechtigkeit als auch den Prinzipien der liberalen Wettbewerbsgesellschaft.
Chancenpolitik statt Parität
Auch hier gilt: eine bürgerliche Chancenpolitik will staatsinterventionistischen Dirigismus und Egalitarismus ebenso vermeiden wie ignorante Nonchalance. Vielmehr wird sie aufmerksam und offen prüfen, wo äußere Benachteiligungen reale Chancen einschränken – und das ist öfter der Fall, als man(n) auf den ersten Blick meinen mag. Stereotype, Vorurteile und Rollenmuster spielen ebenso eine Rolle wie eingefahrene Praktiken der Absprachen auf der Herrentoilette oder der Sitzungstermine am Abend, die Mütter (und Väter) benachteiligen. Und wenn Stellenbesetzungen in Orchestern tatsächlich so ausgefallen sind, dass Frauen nach Vorspielen auf offener Bühne viel seltener genommen wurden als nach Vorspielen hinter dem Vorhang – dann lag hier definitiv eine Benachteiligung vor, wo man allzu schnell gesagt hätte, dass es doch nur um die Sache gehe. Eben nicht.
Eines aber glauben wir nicht: Dass dann, wenn Frauen und Männer sich für traditionelle Rollenverteilungen entscheiden, die Sieger‐ und die Verliererrolle so eindeutig verteilt ist, wie gemeinhin behauptet wird. Die Empirie ist offensichtlich: Männer machen häufiger Karriere oder gründen Unternehmen, Frauen verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern. Männer verdienen mehr, Frauen sterben seltener im Job. Mütter werden im Fall einer Scheidung häufig mit der Erziehung allein gelassen, getrennten Vätern wird oft der Umgang mit ihren Kindern verweigert. Sowohl die Wahrscheinlichkeit, einen Nobelpreis zu gewinnen, als auch obdachlos zu werden, ist als Mann deutlich größer denn als Frau. Und schließlich: Männer sterben früher, Frauen ärmer.
Wer lebt das bessere Leben? Die Antwort hängt von persönlichen Wertmaßstäben ab. Eine liberale Konsequenz kann daher nur sein, faire und reale Chancen zu schaffen und die Freiheitsgrade für alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht weiter zu erhöhen. Aber auch und gerade in einer utopischen Welt größtmöglicher Freiheit werden sich die Lebensverläufe von Männern und Frauen wegen dieser ungleichen Präferenzen immer noch deutlich unterscheiden – und das ist auch gut so.
Eine neue bürgerliche Geschlechterpolitik wird daher proaktiv darauf hinwirken, tatsächlich geschlechtsbedingte Benachteiligungen zu beseitigen. Aber ebenso wird sie Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher Leistungen, individueller Präferenzen und freier Entscheidungen akzeptieren – einschließlich der Entscheidungen zugunsten von Karriereverzicht, Teilzeit oder Familienarbeit, statt diese als falsches Bewusstsein zu stigmatisieren. Vielmehr handelt es um die Vielfalt, die eine bürgerliche Gesellschaft will.
Gleichberechtigung und Pluralismus statt Gleichstellung und Diversität – oder: Eine Offensive für Gerechtigkeit und Innovation
Gleichstellung und Gleichberechtigung stehen für unterschiedliche Gesellschaftsmodelle. Und wer Gleichstellung sagt und meint, Gleichberechtigung zu meinen, weil Begriffe doch nicht so wichtig seien, darf sich nicht wundern, wenn hinterher tatsächlich Gleichstellung praktiziert wird. Gleichstellung ist ein staatsinterventionistischer Ansatz, der auf Ergebnisse zielt und persönliche Präferenzen ignoriert: eine neuständische Modellierung nach Gruppen und Quoten, die dann Diversität genannt wird.
Gleichberechtigung hingegen setzt auf möglichst gleiche Voraussetzungen, die zu unterschiedlichen, ungleichen Ergebnissen führen: zu einem freiheitlichen Pluralismus, der sowohl dem bürgerlichen Gesellschaftsideal als auch dem christlichen Menschenbild entspricht. Gleichberechtigung und Pluralismus als gesellschaftspolitische Leitideen im 21. Jahrhundert setzen auf gerechte Chancen und Voraussetzungen für Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung. Eine proaktive Chancenpolitik verbindet das bürgerliche Aufstiegsversprechen mit einer gesamtgesellschaftlichen Innovationsoffensive, um die bürgerliche Leistungs‐ und Wettbewerbsgesellschaft neu zu beleben. Denn in einem stetig schärfer werdenden Systemwettbewerb des 21. Jahrhunderts werden die westlichen Gesellschaften nur dann bestehen können, wenn sie die Energiequellen ihrer Dynamik und ihres Wohlstands neu entfesseln: Chancen und Freiheit der Individuen mit ihren unterschiedlichen Begabungen, ihrer Originalität und ihrer Leistungsfähigkeit.
Der komplette Text als pdf >
Author
-

Andreas Rödder ist Leiter der Denkfabrik R21 und Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Gegenwärtig wirkt er als Helmut Schmidt Distinguished Visiting Professor an der Johns Hopkins University in Washington. Er war Fellow am Historischen Kolleg in München sowie Gastprofessor an der Brandeis University bei Boston, Mass., und an der London School of Economics. Rödder hat sechs Monographien publiziert, darunter „21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ (2015) und „Wer hat Angst vor Deutschland? Geschichte eines europäischen Problems“ (2018), sowie die politische Streitschrift „Konservativ 21.0. Eine Agenda für Deutschland“ (2019). Andreas Rödder nimmt als Talkshowgast, Interviewpartner und Autor regelmäßig in nationalen und internationalen Medien zu gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung; er ist Mitglied im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident der Stresemann-Gesellschaft.
Alle Beiträge ansehen