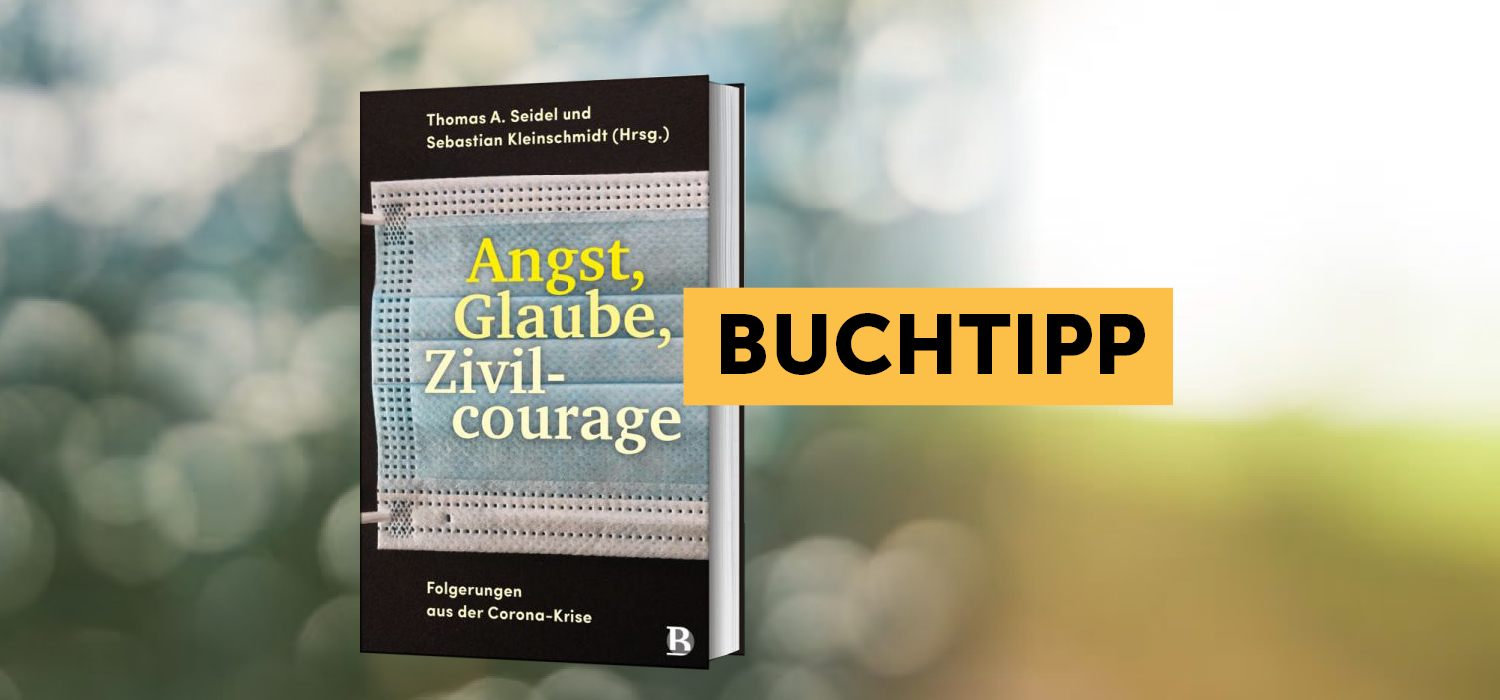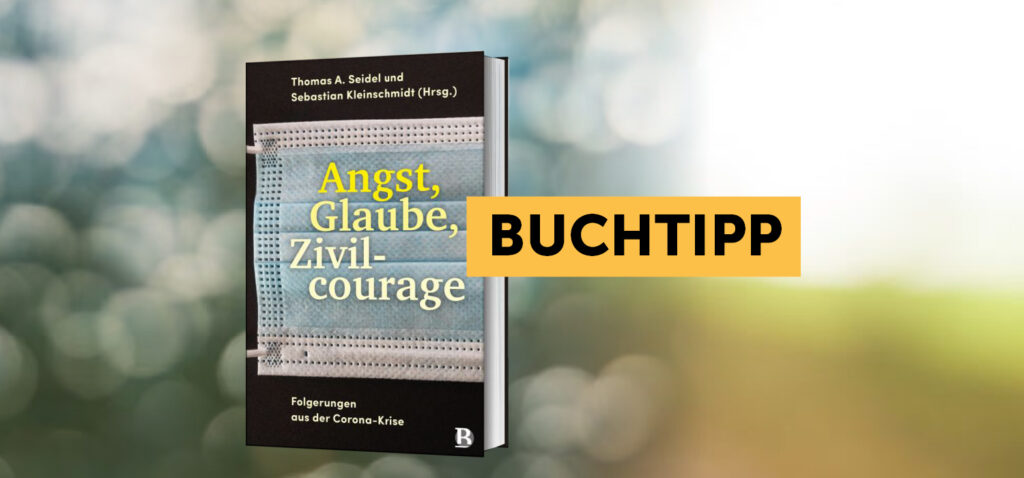R21-Gründungsmitglied Martin Wiesmann blickt voraus auf die letzte Sitzung des EZB-Rats in diesem Jahr, bei der es um die weitere Ausgestaltung der EZB-Anleihekäufe gehen wird.
Am 16. Dezember kommt der Governing Council der Europäischen Zentralbank (EZB) zu seiner letzten Sitzung dieses Jahres zusammen. Vor dem Hintergrund der Inflationsentwicklung in den USA hat die FED entschieden, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. Was wird, was sollte die EZB entscheiden? Und was ist davon zu halten, dass man dieser Tage häufig die Frage gestellt bekommt, ob die EZB mit Blick auf Italien überhaupt eine Wende bei den Anleihekäufen einleiten könne?
Die Inflationsdebatte ist hier ein wichtiger, aber nicht der ausschlaggebende Aspekt. Die USA sind einer derzeit deutlichen Inflationsdynamik ausgesetzt, während die EZB nachvollziehbare Argumente für ihre zurückhaltende Linie hat. Dass es mittel- und langfristig Faktoren gibt, die verstärkten Inflationsdruck auch in Europa erzeugen, und sich auch kurzfristig Handlungsnotwendigkeiten ergeben könnten, steht dabei außer Frage, vorbeugende Vorsicht wäre der EZB also sicher nicht vorzuwerfen.
Dauerhafte Makro-Steuerung?
Auf einem ganz anderen Blatt steht, dass überall Zentralbanken Rollen zugewiesen werden, die sie überfordern. Die jüngste ist die Vorstellung, sie müssten den Klimawandel aufhalten. Eine seit längerem etablierte ist, Zentralbanken könnten makroökonomische Steuerung betreiben. Statt über Zins- und Einlagensteuerung greifen Zentralbanken durch Anleihekäufe am Markt ein, um die Wirtschaft zu stimulieren. Dieses in Japan entwickelte Konzept von „Quantative Easing“ (QE) ist dort gemessen an seinem umfassenden Einsatz von geringer Wirkung geblieben. Als ein Land, das seine Staatsschuld überwiegend selber finanziert, kann Japan mit diesem Ergebnis leben.
In den USA und Europa waren wir in der vergangenen Dekade von Draghis „Whatever it takes“-Rede bis zu den Maßnahmen bei Ausbruch der Covid-Krise Zeuge der Tatsache, dass Zentralbanken zu unverzichtbaren Stabilitätsankern des Finanzsystems geworden sind. Das kann man kritisieren, aber in einer Welt, in der Banken aus regulatorischen Gründen ihre „Ankerrolle“ weitgehend verloren haben und in der die Erwartungen an die Stabilität des Wirtschaftsgeschehens zugenommen haben, liegt darin eine eigene Logik. Die Eurozone würde überdies ohne Draghis beherztes Eingreifen 2012 möglicherweise nicht mehr existieren.
Etwas grundsätzlich anderes jedoch ist die Frage der „Makro-Steuerung“ durch Anleihekäufe, also „QE“ außerhalb akuter Krisen. Zur Frage ihrer Wirkung liegt inzwischen viel wissenschaftliche Literatur vor. In der Praxis, das zeigt uns nicht nur das japanische Beispiel, haben die enormen Ausweitungen der Zentralbankbilanzen eine Reihe von Auswirkungen – wirtschaftliche Stimulanz über die Ausreichung von Bankkrediten ist dabei allerdings am wenigsten feststellbar. Dazu kommt, bisher viel zu wenig diskutiert, dass Liquidität und kurzfristiger Kredit zunehmend besichert über sogenannte „Repos“ bereitgestellt werden. Die Anleihekäufe führen jedoch zu einer Verknappung gerade jener Wertpapiere, die dafür benötigt werden – das Ergebnis entspricht in etwa dem gleichzeitigen Betätigen von Gaspedal und Bremse. Doch unabhängig von der Frage, wie effektiv Anleihekäufe sind – die Einleitung eines „Exits“, also eine Reduzierung von Anleihekäufen, ist für jede Zentralbank eine umso größere Herausforderung, je länger und extensiver sie praktiziert wurden.
In Europa geht es inzwischen jedoch um mehr. Im Vergleich zu den anderen großen Zentralbanken ist die EZB seit jeher der besonderen Anforderung unterworfen, Umverteilungseffekte im Staatenverbund der Währungsunion zu vermeiden. Das Maß an „Flexibilität“, von dem die EZB mit Blick auf die Begrenzungen durch Kapitalschlüssel und Länderobergrenzen bei den Anleihekäufen Gebrauch macht, dürfte inzwischen nach allen Seiten ausgereizt sein. Eine partielle Aufweichung auch selbstgesteckter Grenzen könnte gravierende langfristige Implikationen für die Euro-Governance haben, worauf der Finanzwissenschaftler Friedrich Heinemann jüngst im Handelsblatt hingewiesen hat.
Trendwende jetzt
Die Argumente für den – behutsamen – Einstieg in den Ausstieg scheinen also übermächtig zu sein: abnehmende Effektivität, Inflationsdruck, die Besonderheiten der Euro-Governance, und schließlich die selbstverständliche Notwendigkeit, künstliche Verhältnisse nicht auf Dauer anzulegen. Womit wir bei der eingangs gestellten Frage wären:
Wenn Kapitalmarktteilnehmer auf die Dezember-Entscheidung schauen, dann haben sie primär eines im Kopf: Weiten sich die Renditen italienischer Staatspapiere relativ zu deutschen Staatsanleihen, der sogenannte „Spread“, aus oder nicht? Im März letzten Jahres kam es zu einer plötzlichen Verdoppelung des 10-Jahres-Spreads und einem historischen Einbruch des italienischen Aktienmarkts, als EZB-Präsidentin Lagarde im Rahmen einer Pressekonferenz zur Corona-Krise darauf verwies, die EZB sei nicht für die Begrenzung von Zinsdifferenzen zwischen den Staatsanleihen von Mitgliedsländern zuständig (dabei ging es in der Konferenz um Europa, nicht um Italien – lesenswert dazu Thomas Mayer).
Ist die Lage heute mit damals vergleichbar? Auch heute bevorzugt der Kapitalmarkt den Ersatz des „Pandemic Emergency Purchase Program“ (PEPP) durch die Ausweitung bestehender oder Auflage neuer Programme. Aber: Italien hat über den Wiederaufbaufonds 191,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Die Europäische Union hat damit genau das getan, wofür die EZB stets geworben hat. Die Mitgliedsstaaten der Union haben ihren fiskalischen Einsatz für deren wirtschaftliche Erholung massiv erhöht. Zudem hat die Regierung Draghi einen konsequenten Reformkurs eingeschlagen. Beides wird an den Märkten honoriert. Einen besseren Zeitpunkt für eine Trendwende wird sich also möglicherweise sobald nicht wieder ergeben. Die EZB hat jetzt die Chance, einen Beweis anzutreten: Dass die Einleitung eines Rückzugs zum Katalysator für Vertrauen werden kann – des Kapitalmarktes in Italien, der Bürger der Währungsunion in die EZB
Author
-

Martin Wiesmann sitzt dem Beirat von R21 vor. Nach politik- und betriebswissenschaftlichen Studien in Bonn, Paris und Pittsburgh war er 30 Jahre in der Finanzindustrie tätig, zuletzt als Vice Chairman Investment Banking Europe, Middle East and Africa von J.P. Morgan. Seit 2020 war er u. a. Senior Associate Fellow der Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) für Geoökonomie und arbeitet heute als Managing Partner bei der geopolitischen Beratungsgesellschaft Berlin Global Advisors. Wiesmann ist Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE, Düsseldorf, sowie u. a. Mitglied der Atlantik-Brücke und der Baden-Badener Unternehmer Gespräche. Neben langjährigem Engagement in der Elternarbeit ist er zudem in den Kuratorien des Literaturhauses, des Städelmuseums und der Schirn in Frankfurt sowie der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt aktiv.
Alle Beiträge ansehen