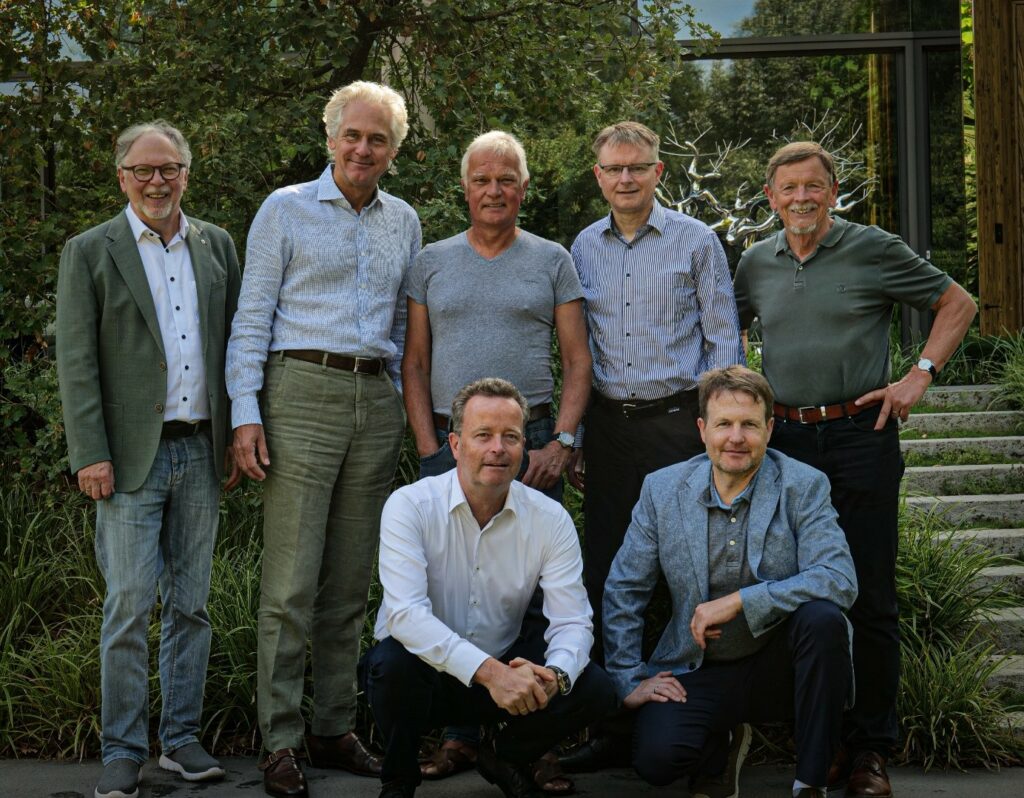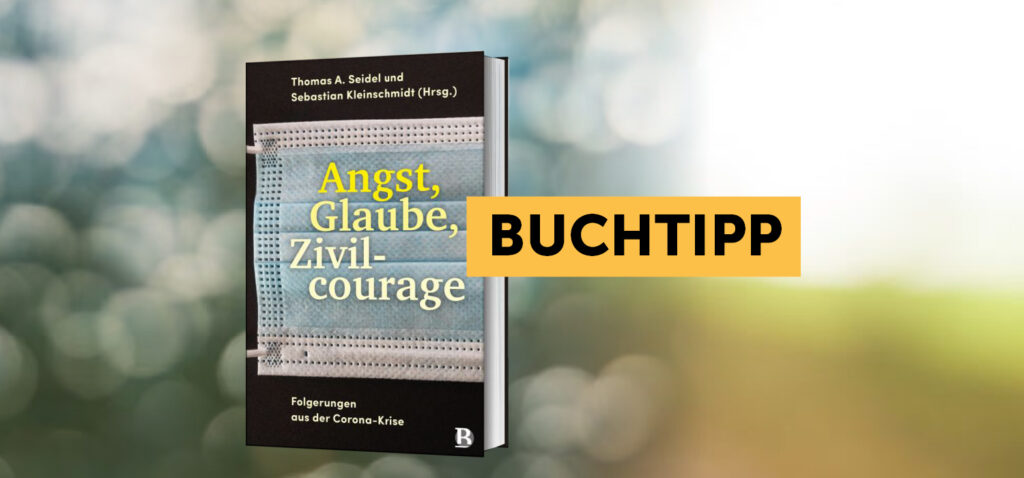„Toxische Männlichkeit“ ist ein Begriff, der Exzesse der traditionellen männlichen Geschlechterrolle beschreibt: Gewaltbereitschaft, Aggression, unterdrückte Emotionalität, Frauenverachtung. Als solcher hat er seine analytische Berechtigung, denn entsprechende Verhaltensweisen gibt es natürlich, auch in modernen, aufgeklärten Gesellschaften. Sie reichen von sexueller Übergriffigkeit bis zu fortgesetzten Benachteiligungen von Frauen im Berufsleben. Auch Schwule und andere Männer, die nicht einem Zerrbild von „echter“ Männlichkeit genügen, können Opfer toxischer Verachtung werden.
Wenn man so will, dann ist Wladimir Putins völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine von A bis Z ein Ausdruck toxischer Männlichkeit, die mit rationalen Argumenten nicht zu stoppen ist – bis hin zu dem ungeheuerlichen Befund, dass das russische Militär die Vergewaltigung von Frauen und Mädchen systematisch als Kriegswaffe einsetzt.
Manchem in Deutschland fällt es vielleicht auch deshalb so schwer, auf die russische Aggression angemessen zu reagieren, weil derartig brutales männliches Verhalten in unserer Gesellschaft zumindest theoretisch geächtet ist – insofern gibt es eine Art kollektive Blockade im Hinblick auf die nötige Wehrhaftigkeit. Leider folgt daraus, dass wir die Gewalt ablehnen, aber keineswegs, dass sie nicht existiert. Und es zeugt schon von erheblicher Begriffsverwirrung, wenn Spiegel-Kolumnistinnen und Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks nun ausgerechnet dem tapferen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskji „toxische Männlichkeit“ vorwerfen, weil er Medienauftritte meist militärisch gekleidet absolviert. Auch einem Reporter der Bild-Zeitung, der seit Kriegsbeginn aus Kiew und von der Front berichtet, wurde dieser absurde Vorwurf gemacht, weil er, wenn er sich im Kampfgebiet bewegt, eine Splitterschutzweste trägt. An solch bizarren Beispielen zeigt sich: Der Begriff kann auch eingesetzt werden, um politisch missliebige Positionen (in diesem Fall ukrainische und deutsche „Kriegstreiber“) zu denunzieren.
Missbräuchlich verwendet und zum Kampfbegriff wird „toxische Männlichkeit“ auch dann, wenn sie auf jedwede Konflikt- oder Konkurrenzsituation zwischen Männern und Frauen angewendet wird. Besonders drastisch zeigte sich das in den Nachwehen der „Me-Too“-Debatte: Die zunächst berechtigte Aufarbeitung von männlichem Machtmissbrauch konnte auch als Drohung an alle Männer verstanden werden. Da es bei „Me Too“ häufig um Vier-Augen-Situationen geht, und da den Opfern selbstverständlich erst einmal zu glauben ist, wird schon der Vorwurf der sexuellen Übergriffigkeit zu einer gefährlichen Waffe. Die bloße Behauptung reicht aus, um einen beschuldigten Mann grundsätzlich zu desavouieren.
Das kann dazu verleiten, Konkurrenten oder Vorgesetzte per Denunziation aus dem Weg zu räumen. Womöglich ist es beispielsweise nicht nur Zufall, dass eigenartig unkonkrete Vorwürfe des sexuell konnotierten Machtmissbrauchs gegen einen ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung genau zu dem Zeitpunkt laut wurden, als er eine in der Redaktion umstrittene politische Linie zur Corona-Politik durchsetzte.
Dem Kampfbegriff korrespondiert eine Weltsicht der Quotenbegeisterung, nach der freiwerdende Planstellen, Ämter und Mandate nicht nur bei gleicher Eignung und Befähigung mit Frauen zu besetzen sind, sondern sowieso – quasi als Kompensation für Jahrhunderte des Patriarchats. Dieser Trend lässt sich gegenwärtig in vielen Bereichen beobachten, in der Verwaltung, im Kulturbetrieb, in der Politik und in der Wirtschaft.
Nicht zuletzt ist das Kabinett der Ampelkoalition ein anschauliches Beispiel für das Quotendenken. Leistung und Qualifikation des oder der Einzelnen wurden zugunsten eines proporzmäßig korrekten Gesamtbildes aufgegeben. Und die Nutznießerinnen dieser Praxis schlagen sich nicht etwa mit Selbstzweifeln herum, sie empfinden offenbar das, was man auf Englisch „sense of entitlement“ nennen würde: Nach der langen Zeit der Ungleichbehandlung steht ihnen die Besserbehandlung nun einfach zu. Was irgendwie nahelegt: Es gibt auch so etwas wie „toxische Weiblichkeit“.
Author
-

Dr. Susanne Gaschke ist Journalistin und Autorin und ehemalige Oberbürgermeisterin der Stadt Kiel.
Alle Beiträge ansehen