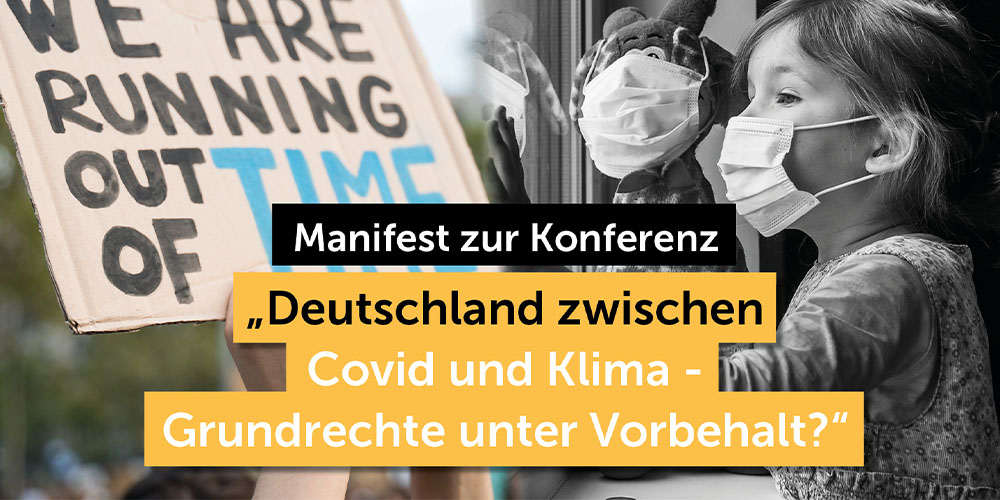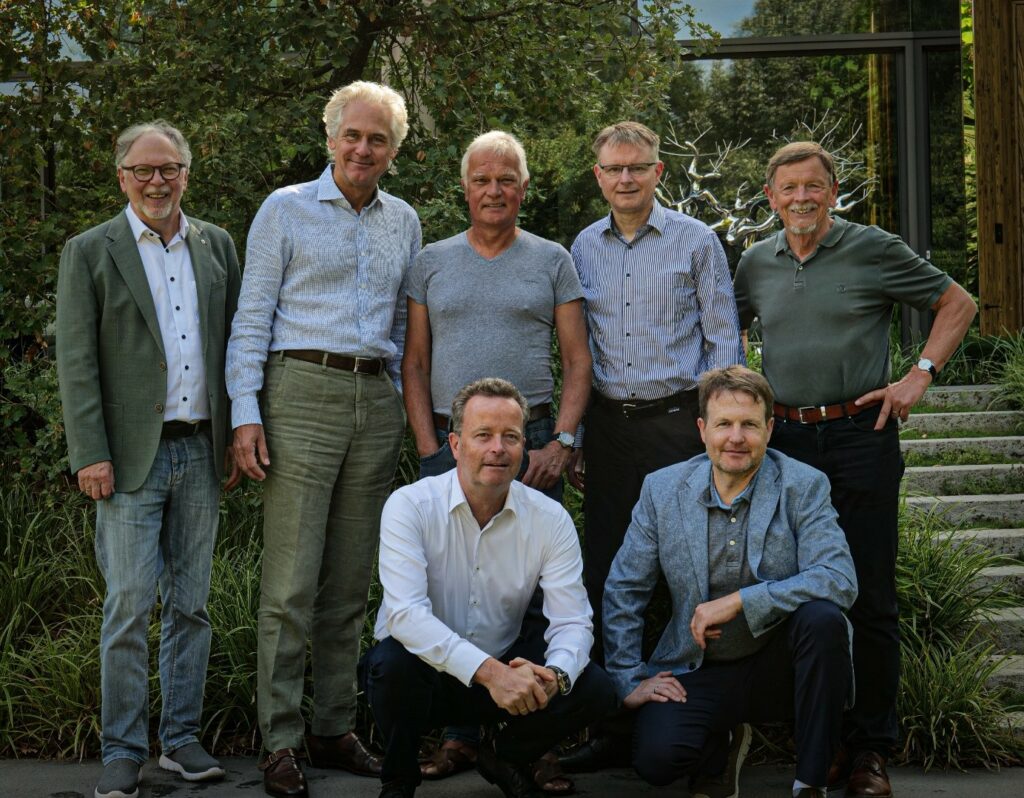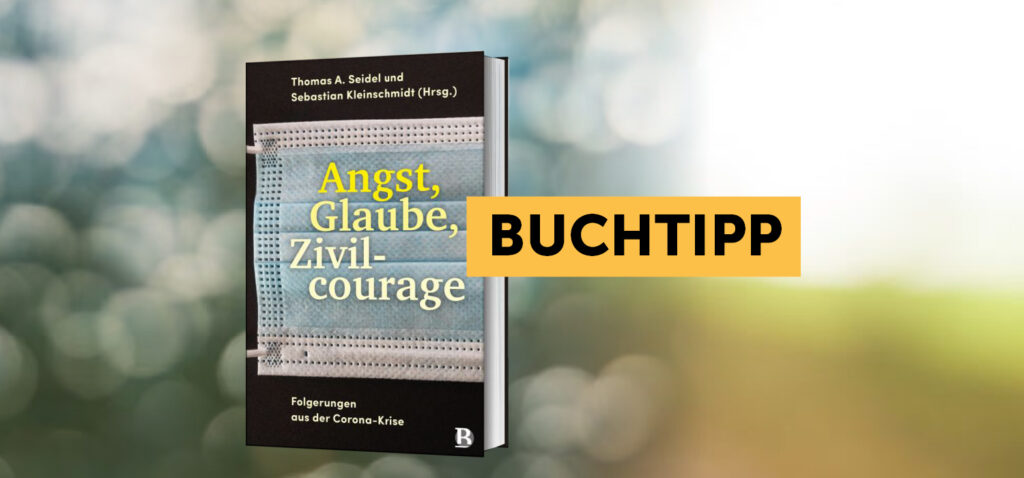Manifest der Denkfabrik Republik 21 im Nachgang zur Konferenz „Deutschland zwischen Covid und Klima – Grundrechte unter Vorbehalt?“ im September 2023 in Berlin
Zwischen März 2020 und April 2023 befand sich unser Land im Ausnahmezustand: Es war die Zeit der Pandemie, eine Zeit, in der Grundrechte so drastisch eingeschränkt worden sind, wie nie zuvor seit Bestehen der Bundesrepublik. Umso erstaunlicher, wie schnell Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft nach dem Ende der Maßnahmen zur Tagesordnung übergegangen sind.
Ein schweres Versäumnis, denn Long Covid ist nicht nur ein medizinisches Thema. Die Corona-Politik hat soziale, psychische und wirtschaftliche Folgen. Mehr noch: Sie hat Zweifel an der Rationalität und der Legitimität politischer Entscheidungsprozesse aufkommen lassen. An die Stelle eines auf Verständigung und Abwägung ausgerichteten öffentlichen Diskurses trat zu häufig die Stilisierung einer existentiellen Bedrohung bis hin zum bewussten Schüren von Panik, auch und gerade durch staatliche Akteure. Daraus wurden nahezu unbeschränkte exekutive Handlungsspielräume abgeleitet: „Es gibt für die Bundesregierung keine roten Linien“, sagte etwa Bundeskanzler Scholz Ende 2021 zur Pandemiebekämpfung.
Es ist nicht übertrieben, rückblickend von einer autoritären Versuchung der liberalen Demokratie zu sprechen. Auch die Justiz hat sich diesem Sog oft nicht entziehen können. Dem Bundesverfassungsgericht warf sein früherer Präsident Hans-Jürgen Papier auf unserer Tagung am 18. September 2023 sogar „Rechtsschutzverweigerung“ vor, weil es insbesondere in den ersten eineinhalb Jahren der Pandemie Hunderte Nichtannahmebeschlüsse getroffen habe, oft ohne jegliche Begründung.
Deshalb müssen wir aufarbeiten, was geschehen ist.
Wir müssen darüber sprechen, nach welchen Maßstäben wir in der Pandemie unsere ethischen Wertentscheidungen getroffen haben. Wir müssen überprüfen, wie angemessen und verhältnismäßig die Entscheidungen waren. Zu Beginn der Pandemie mussten sie unter großer Unsicherheit getroffen werden. Eine ex-post-Perspektive auf die deutsche Pandemiepolitik muss und wird das den Verantwortlichen zugutehalten.
Eine Ex-Post-Perspektive wird aber auch berücksichtigen müssen, dass recht schnell die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Erfahrungen im In- und Ausland zunahmen. Und sie wird fragen, ob die Politik sich selbst darum bemüht hat, eine stärkere Evidenzbasierung zu erreichen. Warum ist Deutschland nicht dem Beispiel anderer europäischer Länder gefolgt, frühzeitig in einer Panelstudie eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung auf in der Pandemie entscheidende Gesundheitsparameter zu untersuchen? Oder hat der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin Recht, wenn er auf unserer Tagung formulierte: „Die Politik wollte damals nicht so viel Evidenz. Sie wollte Ellenbogenfreiheit.“?
Auf jeden Fall ist das Verhältnis von Politik und Wissenschaft, die Art und Weise wie wissenschaftliche Politikberatung während der Pandemie organisiert wurde und wie die wissenschaftlichen und politischen Akteure ihrer jeweiligen Rolle gerecht wurden, eines der Schlüsselthemen der fälligen Aufarbeitung.
Gegenläufig zu anderen Staaten entwickelte sich die deutsche Corona-Politik nach einem moderaten Beginn immer restriktiver und interventionistischer. Bei der Entscheidungsfindung dominierten dabei mehr und mehr zwei Prinzipien: Eindimensionalität der Zielbetrachtung und die Logik des „Der Zweck heiligt die Mittel“.
Ein Großteil der Debatten während der Pandemie drehte sich darum, ob Maßnahmen dem Ziel der Eindämmung des Infektionsgeschehens – und damit der Senkung von Mortalität und Morbidität – nutzen oder nicht. Bringen Masken etwas, nutzen Kontaktbeschränkungen, tragen Schulschließungen zur Dämpfung des Infektionsgeschehens bei? Für viele war mit der Beantwortung dieser Fragen das Thema aber bereits erledigt: Masken nutzen – also Maskenpflicht. Schulen könnten Treiber des Infektionsgeschehens sein – also Schulschließungen. Unter dem aufgeklärt wirkenden Schlachtruf „Hört auf die Wissenschaft“ wurde aus einem Sein ein Sollen abgeleitet.
Verweigert wurde eine Folgenabschätzung für andere konkurrierende Zieldimensionen. Bei Schulschließungen etwa Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen oder ihre altersgerechte kognitive, soziale und emotionale Entwicklung. Selbst fundamentale ethische Fragen spielten bestenfalls eine untergeordnete Rolle: Darf man Kindern und Jugendlichen derart drastische Maßnahmen überhaupt zumuten, erst recht angesichts des immer unstrittigen wissenschaftlichen Befunds, wonach Kinder und Jugendliche selbst durch Covid kaum gefährdet sind? Hat man sie damit nicht im Sinne Immanuel Kants zu einem Mittel für die Zwecke anderer gemacht?
Andererseits ist die Frage, inwieweit die tatsächlich vulnerablen Gruppen geschützt wurden und ob es nicht vorrangig und möglicherweise ausreichend gewesen wäre, effektive Maßnahmen auf diese Gruppen zu konzentrieren, bis heute strittig und letztlich nicht aufgearbeitet.
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist insbesondere das „Zweck heiligt Mittel“-Prinzip niemals akzeptabel. Vielmehr gilt stets das im Grundgesetz verankerte elementare Rechtstaatsprinzip mit dem an den Staat gerichteten Gebot, unter mehreren Alternativen jene mit dem geringstmöglichen Eingriff zu wählen. Während der Pandemie wurde dieses Prinzip im Wesentlichen aufgegeben.
Und so fand zum Zwecke der Verhinderung von Leid und Tod auch Unmenschliches statt:
- Alte, oft demente Menschen wurden Wochen, in manchen Einrichtungen Monate lang, isoliert.
- Ungeimpfte durften über Monate außer in den Supermarkt und in die Apotheke nirgendwo mehr hin, auch dann, als sich längst abzeichnete, dass eine Impfung nicht nennenswert vor der Weitergabe des Virus schützt.
- Menschen mussten alleine sterben, wenn sie Glück hatten, hielt man ihnen noch ein iPad hin, damit sie sich via Skype von ihren Angehörigen verabschieden konnten.
Hier sind Grundrechte in ihrem eigentlich unantastbaren Wesensgehalt eben doch angetastet worden. Im Fall der Menschen, die alleine sterben mussten – und vielleicht nicht nur hier –, sogar Artikel 1 unserer Verfassung.
Begünstigt wurde dies dadurch, dass vor Verwaltungs- und Verfassungsgerichten im Eilrechtsschutz Unsicherheit meist zu Lasten der Freiheitsrechte der Bürger geht, zumal die Verfassungsgerichtsgesetze auch noch verlangen, dass das „Gemeinwohl“ bedroht sein muss, damit in einem Individualfall (!) eine einstweilige Anordnung ergehen kann. Da dies kaum erfüllbar ist, überwiegen schwer kalkulierbare Gefahren für die Allgemeinheit fast immer das Individualinteresse.
Angesichts katastrophischer Szenarien wird es künftig weiterhin schwer möglich sein, in drängenden Situationen Rechtsschutz gegen potentiell grundrechtseinschränkende Maßnahmen zu erlangen.
Zu diskutieren ist daher, wie das Interesse des Einzelnen so gestärkt werden kann, dass dem Gedanken des unantastbaren Wesenskern von Grundrechten wieder stärker Rechnung getragen werden kann – auch und gerade in der Krise.
Insgesamt führte die Dominanz der beiden Prinzipien Eindimensionalität und „Zweck heiligt Mittel“ dazu, dass der gesamtgesellschaftliche Schaden, der durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie entstanden ist, in Deutschland besonders hoch war und ist, möglicherweise sogar höher als der Nutzen, der durch die Maßnahmen auf der anderen Seite erreicht wurde.
Es waren aber nicht immer staatliche Institutionen, die derart rigorose Regeln vorschrieben. Oft waren es Verantwortliche gerade im sozialen Sektor, Leitungen von Heimen, Behinderteneinrichtungen oder Krankenhäusern, die Öffnungsklauseln für menschliche Grenzsituationen nicht nutzten oder die strengen staatlichen Regeln noch verschärften. Auch hier bedarf es einer Aufarbeitung, gleiches gilt für die Kirchen.
Ebenso erwarten wir eine kritische Selbstreflexion der Medien. Weite Teile verbreiteten unkritisch möglichst düstere Prognosen und beteiligten sich teilweise sogar selbst an der Diffamierung von Wissenschaftlern und Intellektuellen, die die Eignung oder Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen in Zweifel zogen. „Reicht das?“ war der kritische Subtext fast jeder Talkshow und fast jeden Kommentars, praktisch nie wurde gefragt: „Ist das zu viel?“. So wurden Medien und Politik „im Wechsel Treiber und Getriebene ihrer eigenen Schreckensszenarien“, wie es die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Hamed formulierte.
Auch dadurch hat sich in der Pandemie das Verständnis von verantwortungsvollem Handeln auf eine gefährliche Weise verschoben. Galt vor der Pandemie vor allem Handeln mit Augenmaß unter bewusster Abwägung aller Folgen, als verantwortungsbewusst, wurde nun ein Handeln als besonders verantwortungsbewusst angesehen, das den einen Zweck, nämlich den Schutz vor einer drohenden Infektion, absolut setzte – koste es, was es wolle. Forderungen nach Ziel-Mittel-Abwägungen wurden als „Inkaufnahme von Toten“ diffamiert. Dabei wurden auch offenkundig unrealistische Ziele propagiert, etwa No Covid oder die Verhinderung der Durchseuchung an Schulen. Unrealistische Ziele aber führen zur Eskalation der Mittel.
Dieser Befund reicht weit über die Pandemie hinaus und mitten hinein in die aktuelle Klimapolitik. Die Prägung des öffentlichen Diskurses, das oft unrealistische Ziel, das jeglicher Abwägung enthoben sein soll – die Parallelen zu Covid drängen sich geradezu auf. Die Eskalation der Mittel ist absehbar, zumal wir in einem „dauerhaften Großkrisen-Narrativ“ (Juli Zeh) leben.
Die Aufarbeitung der Corona-Politik, der ihr zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse und der sie dominierenden Prinzipien ist überfällig, nicht zuletzt für die Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen. Drei Grundsätzen sind dabei für eine liberale Demokratie unverzichtbar:
- Wir müssen Ziele und Mittel in einem in einem offenen Diskurs hinsichtlich ihrer Wirkungen für andere Zieldimensionen abwägen und so stets auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüfen. Außer der Achtung der Menschenwürde ist kein Ziel jeglicher Abwägung enthoben – und der Zweck heiligt eben nicht die Mittel.
- Auch der Zusammenhalt der Gesellschaft, die Bereitschaft zur Verständigung auch mit abweichenden Meinungen ist eine Zieldimension, die es zu berücksichtigen gilt. Der offene Diskurs setzt auf gute Gründe und Überzeugungskraft, nicht auf Angst und Anordnung. Er braucht Medien, die es sich zur Aufgabe machen, den legitimen Meinungskorridor in seiner Breite abzubilden.
- Es gibt einen Kernbereich persönlicher Lebensführung, der durch individuelle Grundrechte unbedingt geschützt ist. In der Pandemie hat dies nicht immer funktioniert. Wir brauchen daher einen ernsthaften Diskurs in Politik, Judikative und Öffentlichkeit, wie wir den eigentlich unantastbaren Wesensgehalt unserer Grundrechte wieder wirklich unantastbar machen können.