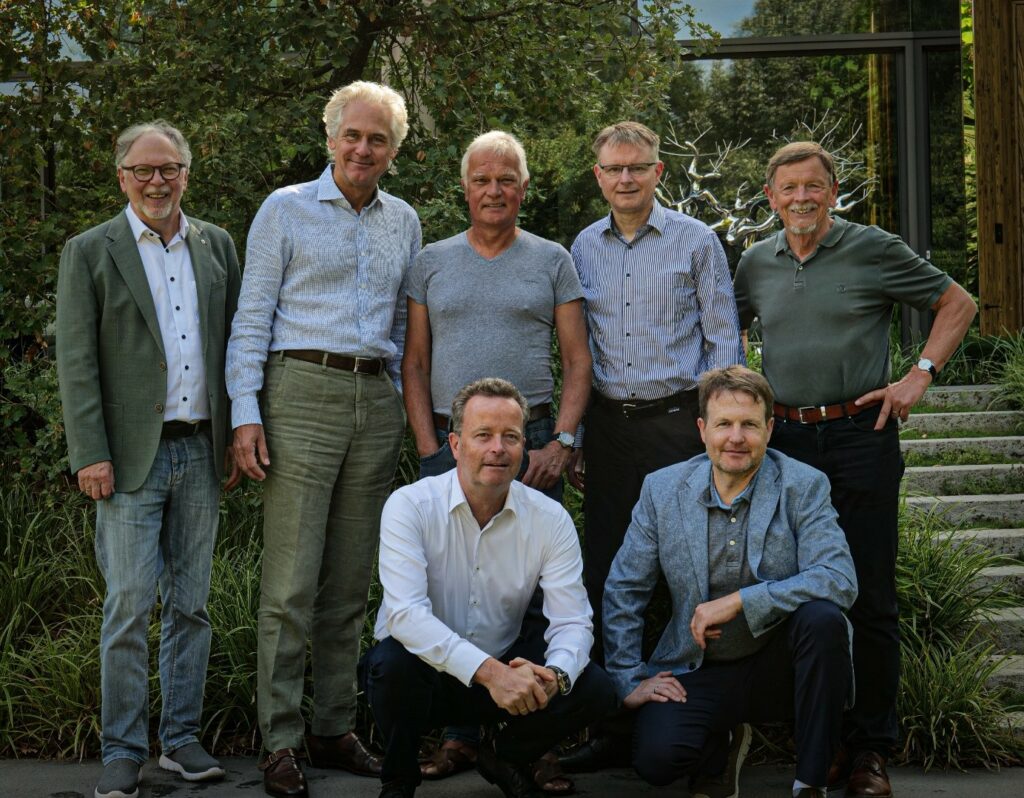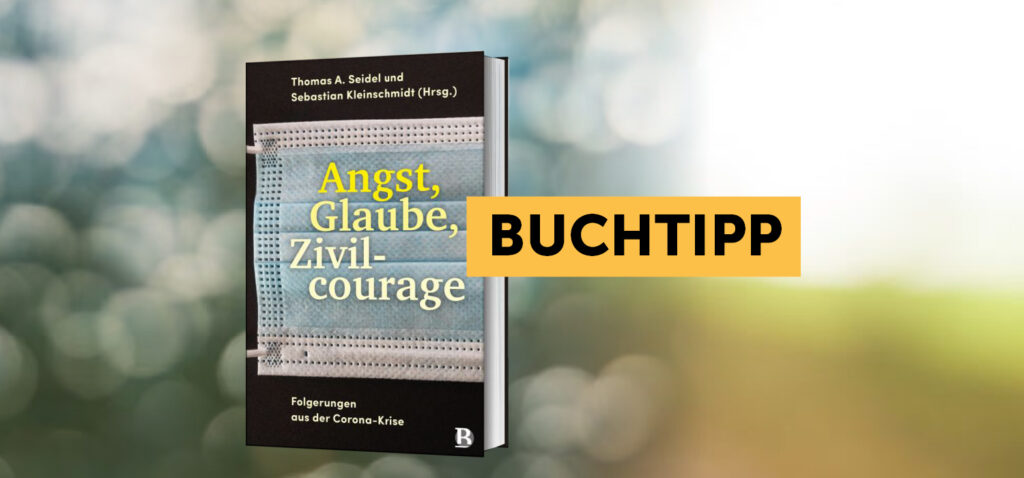Historische Perspektiven
Als „irregulären und einem Monstrum ähnlichen Körper“ bezeichnete der deutsche Rechtsgelehrte Samuel von Pufendorf 1667 das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dreihundertfünfzig Jahre später hätte er seine Bezeichnung auch für die komplizierte Konstruktion der Europäischen Union verwenden können. Sie ist nicht aus einem geplanten Schöpfungsakt hervorgegangen wie die amerikanische Verfassung oder das deutsche Grundgesetz, sondern sie ist pfadabhängig gewachsen, ohne dass unter den Beteiligten, die sich obendrein veränderten, Einigkeit über den gewünschten Endzustand bestanden hätte. Stattdessen war und ist die europäische Integration zu allen Zeiten durch Ambivalenzen gekennzeichnet: von supranationaler Integration und intergouvernementaler Kooperation, Liberalisierungen und Regulierungen, zentralisierenden Tendenzen und zentrifugalen Kräften, Rückschlägen und Fortschritten. Dabei sind drei große Stadien erkennbar: zunächst die politisch relativ lose verbundene Wirtschaftsunion der Europäischen Gemeinschaften mit ihren zunächst sechs, zuletzt zwölf Mitgliedern; dann die Vertiefung zur Europäischen Union von Maastricht 1992 mit dem Kernstück der Währungsunion, begleitet von ihrer Erweiterung auf 28 Staaten in den beiden Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges; und als dritte Phase schließlich punktuelle, aber grundlegende Veränderungen im Zuge existenzieller Krisen in den 2010er Jahren.
35 Jahre méthode Monnet:
Die Europäische Gemeinschaft von Rom
Schon mit dem ersten Schritt der europäischen Integration, der 1950/51 etablierten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wurden Muster und Strukturen ihrer künftigen Entwicklung angelegt: erstens die Institutionen einer supranationalen Hohen Behörde (der späteren Kommission), eines intergouvernementalen Ministerrats (später insbesondere des Europäischen Rats) und einer parlamentarischen Versammlung, die zunächst aus Delegierten bestand und 1979 erstmals direkt gewählt wurde; zweitens die zentrale Bedeutung des französischdeutschen Verhältnisses und drittens der Primat politischer Motive gegenüber ökonomischer Ratio und Kohärenz. So erklärt sich auch das von vornherein angelegte Nebeneinander von freiem Zugang zu den Märkten, vor allem für die deutsche Industrie, und protektionistischer Abschottung vom freien Markt, vor allem der französischen Landwirtschaft.
Ein weiteres Muster lag in der nach dem eigentlichen Gründer der Montanunion benannten „méthode Monnet“: Einzelschritte auf einem Gebiet zogen weitere Integrationsschritte auf anderen Gebieten nach sich. Einen „immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker“ herzustellen, wie die Formulierung seit den Römischen Verträgen von 1957 lautete, war somit als Prozess ohne ein klar definiertes Ziel angelegt. Dieser Prozess war von Anfang an durch eine Folge von Rückschlägen und Fortschritten, von Krisen und Integration gekennzeichnet. Dem ersten Integrationsschritt der Montanunion 1950/51 folgte 1954 das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und diesem wiederum die erste relance mit den Römischen Verträgen über die Europäische Wirtschafts‑ und Atomgemeinschaft. Die französische Blockade eines britischen Beitritts und de Gaulles Politik des leeren Stuhls in den sechziger Jahren ging in die zweite relance européenne und die ersten Erweiterungen in den Siebzigern über, die wiederum in die „Eurosklerose“ der frühen achtziger im Zeichen von Milchseen, Butterbergen und Britenrabatt mündete. Helmut Kohl klagte seinerzeit, diese EG sei „nicht einmal mehr eine Freihandelszone, sondern das ist ein Basar.“ Aber auch diese Krise war nicht von Dauer, sondern wurde Mitte der achtziger Jahre vom einem unerwarteten neuen Integrationsschub abgelöst, der in die Europäische Union von Maastricht führte.
25 Jahre Vertragsänderungen:
Die Europäische Union von Maastricht
Schon die im Februar 1986 unterzeichnete „Einheitliche Europäische Akte“etablierte das Muster dieser zweiten Integrationsphase: Änderungen der europäischenVerträge, wie sie in Maastricht 1992, Amsterdam 1997 und Nizza 2001 vorgenommen wurden, durch den Verfassungsvertrag von 2004 bekrönt werden sollten und nach dessen Scheitern in den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden durch den Vertrag von Lissabon von 2007 zu einem vorläufigen Endpunkt gebracht wurden. Dabei ging es im Wesentlichen stets um institutionelle Fragen wie das Mehrheitsprinzip im Rat oder die Befugnisse des Europäischen Parlaments sowie um die Felder der Zusammenarbeit. Kernstück der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 war der Binnenmarkt, mit dem bis Ende 1992 verbleibende nichttarifäre Handelshemmnisse beseitigt und die vier Grundfreiheiten für Waren, Kapital, Personen und Dienstleistungen verwirklicht werden sollten. Für den seit 1985 amtierenden Kommissionspräsidenten Jacques Delors lag die logische Weiterentwicklung in einer europäischen Währungsunion, zumal sich das 1979 eingerichtete Europäische Währungssystem gegenüber den Volatilitäten der Währungen nach dem Zusammenbruch des Weltwährungssystems von Bretton Woods als nicht krisenfest erwiesen hatte. Aus französischer Perspektive kam erschwerend hinzu, dass die wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik und die daraus resultierende Hochzinspolitik der Bundesbank schwer auf den anderen europäischen Volkswirtschaften lastete und es daher nötig war, „Deutschlands Atombombe“ (François Mitterrand) zu entschärfen. Daher unterbreitete die französische Regierung Ende 1987 einen Vorschlag für eine europäische Währungsunion, der auf weitgehende bundesdeutsche Bereitschaft zur Selbsteinbindung stieß und bereits im Sommer 1989 im Grundsatz angenommen wurde. Die Europäische Währungsunion war also nicht der deutsche Preis für die Wiedervereinigung, wie oftmals gesagt wird, sondern der Preis für die wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik in Europa.
Der Preis für die deutsche Einheit lag stattdessen im Verfahren, mit dem die Währungsunion herbeigeführt wurde. Deutschland verzichtete auf die „Krönungstheorie“, der zufolge zuerst die Konvergenz der Volkswirtschaften hergestellt werden sollte, die dann mit einer gemeinsamen Währung bekrönt würde – was freilich dauern konnte. Stattdessen stimmte die Bundesregierung einem Verfahren gemäß der französischen „Schöpfungstheorie“ zu, der zufolge zuerst die Institutionen geschaffen werden sollten und die Konvergenz dann quasi automatisch folgen werde (wobei die Bundesregierung mit stabilitätsorientierten Beitrittskriterien dann doch noch einen Teil der deutschen Krönungstheorie durchsetzte).
Die in Maastricht beschlossene Währungsunion, 1998 zunächst als Buchwährung und 2002 für den Bargeldumlauf eingeführt, verband sehr unterschiedliche Prinzipien. Die Geldpolitik wurde vergemeinschaftet und einer unabhängigen Europäischen Zentralbank (EZB) übertragen, die primär auf den Erhalt der Geldwertstabilität verpflichtet und der monetäre Staatsfinanzierung verboten wurde. Die Fiskalpolitik verblieb demgegenüber in der Selbstverantwortung der Einzelstaaten, die einem Regelsystem nationaler Verschuldungsgrenzen unterworfen wurden. Gegenseitige Schuldenhaftung wurde vertraglich ausgeschlossen, explizit auch keine Transferunion begründet.
Diese Konstruktion brachte freilich eine Reihe von Problemen mit sich. In vielen Staaten herrschte insbesondere in wirtschaftlichen Krisensituationen wenig Bereitschaft, sich den Regeln der Währungsunion zu fügen. Zugleich verfügte die Währungsunion weder über verbindliche Sanktionsmechanismen noch über wirksame Sanktionsmöglichkeiten wie etwa, als ultima ratio, den Ausschluss eines Mitglieds. Und schließlich verfügte die Währungsunion nach Abschaffung der Möglichkeit von Wechselkursanpassungen auch nicht über Mechanismen zum Ausgleich volkswirtschaftlicher Ungleichgewichte. Die deutsche Vorstellung besagte, dass ein solcher Ausgleich über wettbewerbsorientierte Strukturreformen der betroffenen Länder erfolgen müsse (so wie es Deutschland mit der Agenda 2010 tat). Diese Logik aber war weder klar formuliert und eindeutig geregelt, noch wurde sie von allen Mitgliedern der Währungsunion geteilt. Viele von ihnen machten vielmehr die deutschen Außenhandelsüberschüsse und private Finanzströme für die Probleme verantwortlich.
Überhaupt blieben politisch‑ und ökonomisch-kulturelle Differenzen innerhalb Europas bestehen, wie zum Beispiel zwischen deutscher Wettbewerbs‑ und Stabilitätsorientierung und französischer Konjunktur‑ und Industriepolitik. Es waren Formelkompromisse zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen – wie der „Stabilitats‑ und Wachstumspakt“ von 1997 –, die Einigungen einerseits überhaupt erst möglich machten. Andererseits legten sie den Grund für künftige Konflikte.
„Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“ – Angela Merkels Beschwörung aus dem Jahr 2010 zeigte, dass die Währungsunion das Kernstück der Europäischen Union von Maastricht war. Indem der Vertrag Entscheidungskompetenzen auf die europäische Ebene verlagerte und mit der Revisionsklausel weitere Integrationsschritte und Vertiefungen in Aussicht stellte, bedeutete er einen Konstitutionalisierungsschub der Europäischen Union, die sich damit zugleich als die entscheidende politische Institution in Europa nach dem Ende des Kalten Krieges etablierte.
Daher wurde sie auch zum Objekt von Beitrittswünschen der postkommunistischen Staaten in Ostmittel‑ und Südosteuropa, die von der NATO Sicherheit und von der EU vor allem ökonomische Unterstützung erwarteten – und diese zugleich vor das gravierende Problem stellten, Vertiefung und Erweiterung zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund beschloss der Europäische Rat 1993 in Kopenhagen Kriterien für eine Osterweiterung: stabile demokratische Strukturen, eine wettbewerbsfähige Marktwirtschaft sowie die Übernahme der Rechte, Pflichten und Regelungen, des acquis communautaire der Europäischen Union. Am 1. Mai 2004 erweiterte sie sich mit einem Schlag von 15 auf 25 Mitglieder. Die Bereitschaft, Regeln zu beachten und Ziele zu erreichen, um die Voraussetzungen zu erfüllen, war dabei, wie sich herausstellte (und das galt für die Währungsunion nicht anders), auf dem Weg zur Mitgliedschaft deutlich ausgeprägter als nach erfolgtem Beitritt. Zugleich wurden grundlegende kulturelle Differenzen sichtbar. Für die Staaten Ostmittel‑ und Südosteuropas war der Gewinn der Freiheit vom Kommunismus 1989 mit dem Wiedergewinn der nationalen Souveränität gegenüber der Sowjetunion verbunden. Vor diesem Hintergrund herrschte trotz der Übernahme des acquis communautaire keine uneingeschränkte Bereitschaft, diese wiedergewonnene Souveränität an eine „immer engere Union“ oder eine europäische Zentralgewalt abzutreten. Bestätigt sehen konnte sich solche Kritik durch das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag, das eindeutig mahnte, die „europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten darf nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse mehr bleibt.“ Mark Gilbert spricht von europäischer „Hybris“ im frühen 21. Jahrhundert, in der sich Überambition und Leistungsrückstand verbanden. Die „Lissabon-Strategie“ des Europäischen Rats aus dem Jahr 2000 kündigte an, die EU innerhalb von zehn Jahren „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.“ Tatsächlich stand zehn Jahre später die Währungsunion am Rande des Scheiterns. Das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts brachte eine Folge von fünf geballten Krisen mit sich. Sie prägten eine dritte Phase der europäischen Integration, in der sich die Frage stellte, ob diese Krisen abermals Motoren der Integration sein würden oder ob sie ihre Existenz gefährdeten.
Verfassungswandel durch Krisenmanagement: Die EU seit 2010
Als die Rating-Agentur Fitch am 9. Dezember 2009 die Kreditwürdigkeit Griechenlands herabstufte, sprang die Subprime-Krise in den USA auf die Europäische Währungsunion über. Nach dem Start des Euro waren die Kreditzinsen in der gesamten Währungsunion, vor allem im Süden Europas, merklich zurückgegangen und hatten einen kreditfinanzierten Boom ausgelöst. Als die Blase platzte und sich die Staats‑ und Regierungschefs der Eurozone am 7./8. Mai 2010 zu einem Krisengipfel trafen, malte der französische Präsident Nicolas Sarkozy das Gespenst einer Explosion der Europäischen Union an die Wand. Der in den folgenden Jahren entwickelten Euro-Rettungspolitik ging es ums Ganze –„whatever it takes“, wie EZB-Präsident Mario Draghi 2012 die Devise ausgab. Vor die Alternative gestellt, dass Griechenland die Währungsunion verlassen müsse (was aber vertraglich nicht vorgesehen war) und eine Kettenreaktion drohe, oder dass die Währungsunion auf eine offene Transferunion umgestellt würde, was weder die verfassungsrechtliche Lage noch die politische Öffentlichkeit in Deutschland getragen hätten, setzte die Euro-Rettungspolitik auf Krisenhilfen gegen Auflagen zu Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen. Damit konnte die Krise einstweilen stillgestellt werden – unter massivem Mitteleinsatz, unter Aufwertung der EZB zum zentralen Spieler und unter äußerster Dehnung der Verträge bis zu dem Punkt, an dem das Bundesverfassungsgericht der EZB 2020 bescheinigte, mit dem Kaufprogramm für Staatsanleihen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit missachtet und ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Jedenfalls war aus der Europäischen Währungsunion, dem Herzstück des Vertrags von Maastricht, eine hybride Konstruktion aus defizitärem Regelsystem und situativen Krisenmaßnahmen ohne erkennbares Ziel und Gesamtdesign geworden.
Noch bevor die Euro-Schuldenkrise 2015 einem Höhepunkt zustrebte, war die EU zumindest indirekt am Aufflammen eines neuen Krisenherdes beteiligt. Die 2009 aufgelegte „Östliche Partnerschaft“ zielte auf die politische Assoziierung und wirtschaftliche Anbindung postsowjetischer Staaten, unter anderem der Ukraine. Als der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch am Ende eines vierjährigen Verhandlungsprozesses ankündigte, das Assoziierungsabkommen aus Rücksicht auf die Beziehungen zu Russland nicht zu unterzeichnen, brach der „Euromaidan“, die zweite ukrainische Revolution aus, die im Februar 2014 gewaltsame Züge annahm und Russland – das sich ohnehin von einer Expansion der EU bzw. der NATO bedroht wähnte – den Vorwand lieferte, die Krim zu annektieren und die Ostukraine militärisch und politisch zu infiltrieren. Die östliche Partnerschaft, so Marc Gilberts Urteil, „hatte unabsichtlich einen Krieg entfacht.“
Unterdessen stiegen die Zahlen von Asylbewerbern, die sich im Gefolge von Bürgerkriegen, insbesondere in Syrien, von Armut und Überbevölkerung im subsaharischen Afrika und von Kürzungen der Zuwendungen vieler Staaten für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen auf den Weg nach Europa machten – über das Mittelmeer oder über den Balkan und immer wieder begleitet von humanitären Tragödien. Über eine Million Migranten brachten 2015 das europäische Grenzregime zum Scheitern: das Schengen-Abkommen, das die europäischen Binnengrenzen durch eine gemeinsame Außengrenze ersetzte, und die Dublin-Verordnungen, denen zufolge das Erstaufnahmeland für die Asylverfahren zuständig war. Unter dem Druck der hohen Zahlen ließen Italien und Griechenland indessen Migranten passieren, die in den europäischen Norden und vor allem nach Deutschland strebten. Während andere Länder ihre Grenzen schlossen, hielt Deutschland die seinen offen, auch wenn sich nationales Recht, europäische Regelungen und humanitäres Völkerrecht dysfunktional überlagerten. Stattdessen erwirkte Deutschland einen Mehrheitsbeschluss zur Verteilung von Migranten innerhalb der EU im Ministerrat, was wiederum auf erbitterten Widerstand insbesondere in den osteuropäischen Staaten stieß, die nicht bereit waren, Asylbewerber, insbesondere muslimische Migranten aufzunehmen. Eine vorläufige Entspannung trat erst ein, als die EU im März 2016 ein Abkommen mit der Türkei schloss – die damit ein Druckmittel gegenüber der EU in der Hand hielt, die Grenzen zu öffnen. Drei Monate später entschied sich die Wahlbevölkerung des Vereinigten Königreichs mit knapper Mehrheit in einem Referendum, die Europäische Union zu verlassen. Der „Brexit“ stellte den ersten Fall dar, dass ein Mitgliedstaat aus der Europäischen Union austrat, und konterkarierte damit das Narrativ der „immer engeren“ Union, die nur eine Richtung, nämlich „mehr Europa“ kenne. Zugleich sorgte der Brexit in den langwierigen Austrittsverhandlungen, die folgten, einstweilen für einen Schulterschluss der verbleibenden Mitgliedstaaten, unter denen Kettenreaktionen jedenfalls ausblieben.
Zugleich nahm die Spannung zwischen zentralisierenden und zentrifugalen Kräften innerhalb der EU zu. Während der „Green Deal“ der 2019 gebildeten Kommission unter Ursula von der Leyen unverkennbar zentralisierende Züge trug, wuchsen die Differenzen mit Ungarn und Polen über der Frage der Rechtsstaatlichkeit und mit den vier Višegrad-Staaten allgemein. Dabei wurden ebenso politisch-kulturelle Differenzen auf der West-Ost-Achse erkennbar wie die Auseinandersetzungen mit den „sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden, später auch Finnland) über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU im Frühjahr 2020 sie auf der Nord-Süd-Achse zum Vorschein brachten. Während sich hier ein neues Maß an Fragmentierung zu manifestieren schien, das die Entscheidungsprozesse erschwerte, zeigte sich nach Ausbruch der Pandemie, dass die deutsch-französische Achse nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, als Emmanuel Macron und Angela Merkel sich im Mai 2020 auf einen schuldenfinanzierten Solidarfonds zur Bekämpfung der Pandemiefolgen verständigten. Auf einem außergewöhnlich langen und schwierigen Gipfel vom 17.–21. Juli 2020 wurden sowohl ein Rekord-Finanzrahmen von über einer Billion Euro für sieben Jahre als auch der 750 Mrd. Euro umfassende, erstmals durch gemeinsam aufzunehmende Schulden finanzierte „Next Generation EU“- Fonds beschlossen, der zur knappen Hälfte nicht rückzahlbare Zuschüsse und zur guten Hälfte rückzahlbare Kredite an besonders betroffene Regionen und Bereiche ausgibt. Hatte sich die EU in der Pandemie nach uneinheitlichem Beginn im Sommer 2020 als verstärkt handlungsfähig erwiesen, so führte die zugleich beschlossene gemeinsame Beschaffung von Impfstoff im Jahr darauf zu Engpässen und Verzögerungen, die das Vertrauen in Kommission und Union beschädigten, und dazu führten, dass einzelne Mitglieder Kooperationen jenseits der EU-Grenzen suchten. Die Folge überstandener schwerer Krisen seit 2010 zeugt einerseits von einer signifikanten Resilienz der Europäischen Union. Andererseits identifizierten kritische Beobachter ein problematisches Muster, das für die dritte Phase der europäischen Integration im Zeichen der Krisenbewältigung konstitutiv wurde:
Der Ignoranz von Problemen im Vorfeld folgten improvisierte Notfallmaßnahmen ohne Gesamtdesign und Nachhaltigkeit, die zur Etablierung ungeplanter neuer Strukturen und zu einem faktischen Verfassungswandel ohne Vertragsänderung führten (Agustín José Menéndez).
Die europäische Integration: Eine Zwischenbilanz
Zieht man eine Bilanz der europäischen Integration, so steht auf der Seite der Aktiva die Form des Umgangs der Europäer miteinander. Luxemburg und die Niederlande, Polen und Lettland sind nicht mehr Einmarschgebiete der Armeen benachbarter Großmächte, sondern stellen führende Repräsentanten der Europäischen Union. Und auch wenn Krisengipfel zu mühsamen oder unbefriedigenden Ergebnissen führen, so zeugen sie doch von einem elementaren Willen zu gemeinsamen Lösungen, wo die europäischen Regierungen durch die Julikrise 1914 in den Krieg gesteuert waren. Den historischen Unterschied markiert auch das zweite Aktivum: der Beitrag der europäischen Integration zur Stabilisierung Ostmittel‑ und Südosteuropas nach dem Ende des Kalten Krieges. Allen neuen Mitgliedern der EU blieben die Ausbrüche von Gewaltpotentialen erspart, wie sie sich in den postjugoslawischen Kriegen oder in der Ukraine ereigneten. Stattdessen profitierten auch sie vom dritten großen Aktivum: dem Wohlstand der EU und ihres Binnenmarktes.
Diesen Aktiva stehen freilich auch Passiva gegenüber: eine charakteristische Verbindung von rhetorischer Überambition und faktischer Mindererfüllung. Statt zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu werden, stand eine defizitär konstruierte Europäische Währungsunion zehn Jahre nach ihrem Beginn am Rande des Scheiterns. Und auch die Vergemeinschaftung der Grenzen und der Migrationspolitik erfüllte nicht die Kriterien, die von funktionsfähiger Staatlichkeit erwartet werden. Schließlich hat es die Europäische Union trotz aller Reformen nicht vermocht, zu einem global player zu werden; stattdessen hat sie ihre am ehesten global agierende Macht, das Vereinigte Königreich, durch Austritt verloren.
All dies konfrontiert die Europäische Union in den zwanziger Jahren mit ihrem konstitutiven Spezifikum: einem immer noch zunehmenden Maß an Ambivalenzen. Hatte das Europäische Parlament 2014 – abermals durch faktischen Präzedenzfall statt durch beschlossenen Verfassungswandel – ein supranationales parlamentarisches Recht zur Designation der Kommission erstritten, so kassierten die Staats‑ und Regierungschefs ebendies 2019 wieder ein. Während die Kommission durch Green Deal, Mehrjährigen Finanzrahmen und Next Generation EU-Fonds die zentralisierenden Tendenzen stärkt und sich ein eigener Hybrid zwischen einzelstaatlichen Regierungen und Kommission ausgebildet hat, nehmen mit der Verfestigung der vier Visegrád-Staaten und den Sparsamen Fünf die zentrifugalen Kräfte zu. Der Gipfel im Juli 2020 dokumentierte, dass es immer schwieriger wird, überhaupt eine Einigung zu finden – und schuf unter deutscher Mithilfe zugleich den Präzedenzfall für lange vor allem von Deutschland abgelehnte gemeinschaftliche Schulden. Ebenso zeugte die gemeinsame Beschaffung von Impfstoff außerhalb der vertraglichen Zuständigkeit der EU von weitergehender Vergemeinschaftung – und schuf mit ihren Mängeln zugleich Delegitimationspotentiale für die Union.
Zentralisierende Tendenzen und zentrifugale Kräfte bei ungelösten Fundamenatalproblemen der Währungsunion und fortgesetzten institutionellen Rivalitäten – das sind die Kenndaten der EU nach der Pandemie. War und ist dies eine neuerliche Dialektik der méthode Monnet auf dem Weg der ever closer union? Oder werden zunehmende Spannungen angelegt, die Risse im Fundament erzeugen? Die historische Erfahrung spricht für die Langlebigkeit ambivalenter Hybride. Sie besagt aber auch, dass es keine Automatismen gibt – weder in Richtung des Niedergangs noch eines Endzustands. Und vor allem lässt die historische Erfahrung erwarten, dass die Zukunft offen ist. Der europäischen Integration helfen daher weder Schwarzmalerei noch Schönfärberei und auch keine Ideologie, sondern zukunftsoffener Realismus einer flexiblen, selbstreflexiven und selbstkritischen Union, die sich auf den Kern ihres Auftrags konzentriert: Mehrwert zu schaffen, wo sie Mehrwert verspricht.
Der komplette Text als pdf >
Author
-

Andreas Rödder ist Leiter der Denkfabrik R21 und Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Gegenwärtig wirkt er als Helmut Schmidt Distinguished Visiting Professor an der Johns Hopkins University in Washington. Er war Fellow am Historischen Kolleg in München sowie Gastprofessor an der Brandeis University bei Boston, Mass., und an der London School of Economics. Rödder hat sechs Monographien publiziert, darunter „21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ (2015) und „Wer hat Angst vor Deutschland? Geschichte eines europäischen Problems“ (2018), sowie die politische Streitschrift „Konservativ 21.0. Eine Agenda für Deutschland“ (2019). Andreas Rödder nimmt als Talkshowgast, Interviewpartner und Autor regelmäßig in nationalen und internationalen Medien zu gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung; er ist Mitglied im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident der Stresemann-Gesellschaft.
Alle Beiträge ansehen