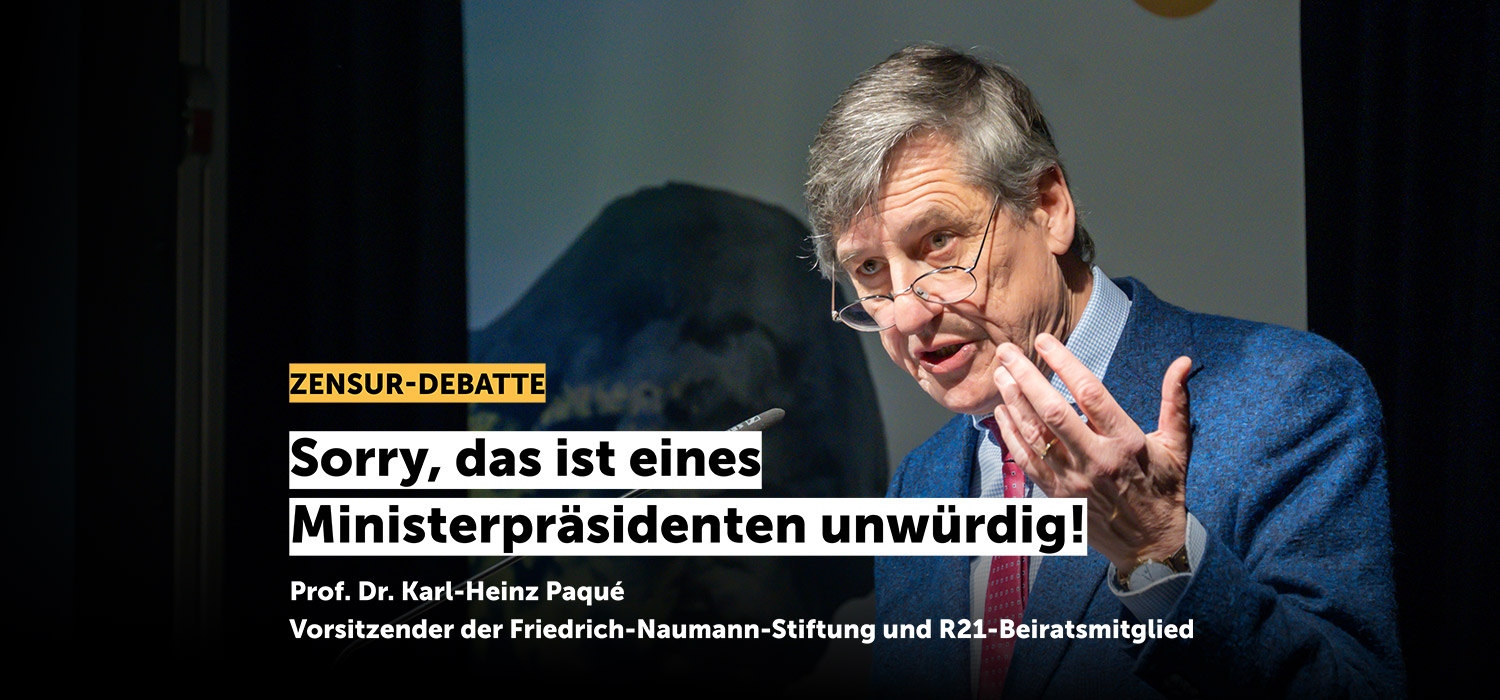Zwischen Voluntarismus, Vision und Revision
Die Entscheidung für die Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung am 11. Januar 1999 für zunächst 11 Mitglieder der Europäischen Union ist unter den Schritten zur europäischen Einigung sicher der zugleich ungewöhnlichste und weitreichendste. Jahrzehnte lang Gegenstand intensiver konzeptioneller Vorarbeit in unzähligen Kommissionen, hatte sich gegen Ende der 1980er-Jahre ein politischer Konsens in Deutschland entwickelt, demzufolge eine Gemeinschaftswährung nur Ergebnis einer politischen Union sein konnte.
Es kam bekanntlich anders. Weil die Vision einer politischen Union, über die immerhin zwischen Frankreich und Deutschland verhandelt wurde, nie eine klare Kontur in der politischen Debatte bekam, war es vergleichsweise unkompliziert, sich von ihr nach einer kurzen diskursiven Aufwallung wieder zu verabschieden. Auch der Rücktritt eines höchst respektierten Präsidenten der Bundesbank hielt das Rad der Geschichte nicht auf. Helmut Kohls Mantra von der Einheit Deutschlands als Treiber für die Einheit Europas war wohl das wirkmächtigste politische Narrativ seiner Zeit. Es ließ auch vergessen, dass den Zeitgenossen die ersparten Transaktionskosten, die eine Gemeinschaftswährung als zählbaren wirtschaftlichen Vorteil laut ihrer Verteidiger mit sich bringen sollten, wie kleine Münze erschienen, gemessen an dem schicksalhaften Schritt der Aufgabe währungspolitischer Eigenständigkeit.
Diese Geschichte ist vielfach beschrieben worden. Warum ist sie jetzt noch relevant? Weil die Währungsunion nicht abgeschlossen und ihre tägliche Präsenz in unserem europäischen Bürgerleben nur oberflächlich so selbstverständlich geworden ist, wie die des Binnenmarkts und der Freizügigkeit im Schengenraum.
Ambivalenz von Erfolg und Scheitern
Die Konstrukteure des Euro muss man dabei vor wohlfeiler Kritik in Schutz nehmen. Sie haben vermutlich das Beste aus dem gemacht, was sich zwischen politischen Zwängen und den diversen Konzepten für eine bessere Gestaltung des Währungsraumes der Europäischen Gemeinschaft realisieren ließ. Anders als der höchst kritische angelsächsische akademische Mainstream äußerte sich der Economist 1998 in einer Sonderausgabe zum Start der Währungsunion respektvoll:
„Europe has barely got round to discussing the international effect of the euro; yet this will be huge, and may cause some concern in America. Once again, there is no past experience to go on. The international financial system is bracing itself for something entirely new on January 1st next year: the arrival in one bound of a major international currency, and one that was created by not just one sovereign government but by many.“
Bei seiner Einführung wurde die gemeinsame Währung ein Erfolg am Kapitalmarkt. Die Währungsumstellung verlief, von anfänglicher Schwäche in den ersten Handelsmonaten abgesehen, geräuschlos. Ihr Erfolg wurde zum 10. Jahrestag von Jean-Claude Trichet mit berechtigter Genugtuung bei einer Rede in Osnabrück mit den Worten kommentiert: „Das Versprechen ‚der Euro wird so stark wie die Mark’, wurde eingehalten.“
In einem überschaubaren Zeitraum avancierte die Gemeinschaftswährung mit einem Anteil von rund 35 % an internationalen Zahlungsvorgängen zu dem global zweitwichtigsten Zahlungsmittel hinter dem Dollar mit rund 45 %. Als Europäische Gemeinschaftsinstitution waren die Vertreter der Mitgliedsländer in der Europäischen Zentralbank strikt der Verantwortung für den Währungsraum und nicht ihren Herkunftsländern verpflichtet. Konzipiert als die unabhängigste unter den maßgeblichen Zentralbanken, zog und zieht sie zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Kritik auf sich, aber das galt auch für die Bundesbank früher, und es gilt für die Federal Reserve und andere Zentralbanken heute. Dass die Bilanz der Gemeinschaftswährung nach gut zwanzig Jahren trotzdem durchgängig ambivalent ausfällt, hat zwei fundamentale Gründe: Sie ist eine gemeinsame Währung von demokratischen Mitgliedsländern, die erstens ihrsouveränes Budgetrecht verteidigen und deren Mangel an ökonomischer Konvergenz zweitens über die Zeit nicht kleiner, sondern größer wurde. Naiv wäre freilich zu glauben, ohne den Euro wäre alles besser gewesen. Die politischen Schlachten, die zwischen Deutschland und Frankreich um die Aufwertung der D-Mark gegen den Franc geschlagen wurden, der regelmäßige Druck auf deutsche Bundeskanzler, als eine Art „lender of last resort“ Italiens europäische Verantwortung zu zeigen: Schon weit vor dem Beginn der Vorläufer der Europäischen Wirtschafts‑ und Währungsunion war klar, dass Deutschland sich seiner Rolle als wirtschaftlich führendes Land in der Mitte Europas nicht einfach würde entziehen können. Gleichermaßen naiv, wer glaubte, mit dem Euro ließen sich die Divergenzen in Europa von selber lösen. Georges Pompidous Optimismus, dass in einer Art „europäischem Goldstandard“ mit dem regelmäßigen Gesichtsverlust auch die Gründe für die Abwertungsrunden des Franc gegen die D-Mark entfallen würden, war genauso wenig angebracht wie das Versprechen an den deutschen Steuerzahler, nie für den Gemeinschaftsraum in Anspruch genommen zu werden, der mit einer Schulden‑ und Defizitregel hinreichend abgesichert sei.
Kostenlose Konvergenz für den Süden, kostenlose Stabilität für den Norden: Aus dieser über die ersten Jahrzehnte hinweg dominierenden Einheit der Illusionen resultiert die Sprengkraft, der heute der Währungsraum ausgesetzt ist. Die eine ist nicht durch den Ruf nach einer Gemeinschaftshaftung in Form von Eurobonds einzulösen, die andere nicht beim Bundesverfassungsgericht einzuklagen.
Vielleicht nicht naiv, aber mit Sicherheit kurzsichtig sind diejenigen, die deshalb den Euroraum schon heute abgeschrieben haben. Neue Institutionen wie der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM, so kontrovers sie auch sein mögen, neue Strukturen wie die Bankenunion, so wenig sie auch als abgeschlossen gelten können, dokumentieren den Willen der Euroländer, sich ihr Schicksal nicht aus den Händen nehmen zu lassen, aus Fehlern zu lernen und Defizite zu beseitigen. Diese ausgeprägte Reparaturbereitschaft findet in der Qualifizierung der Europäischen Union als ein „lernendes System in Bewegung“ eine aus guten Gründen wohlwollende Würdigung.
Eine weniger schmeichelhafte, aber dafür realistische Einordnung der Governance der Eurozone nahm ein kluger angelsächsischer Beobachter in der Formulierung „fuzzy, but stable“ vor. Mit Blick auf die inzwischen dramatisch gestiegenen Verschuldungs-Levels und die von „Le Monde“ schonungslos aufbereitete, ernüchternde wirtschaftliche Bilanz der Eurozone4 muss der Realist von heute dieses Diktum trotz der erheblichen Reformanstrengungen der vergangenen Jahre in einem entscheidenden Aspekt abwandeln: „Fuzzy AND fragile“, dürfte es nun zutreffender lauten. Die Währungsunion ist „fuzzy“, weil die europäischen Budgetregeln eher ein Eigen‑ als ein Gemeinschaftsleben entfaltet haben, und weil im Falle einer nächsten Solvenzkrise offen ist, nach welchen Regeln das Eurosystem bei der Verteilung von Krisenlasten verfahren würde. Und sie ist „fragile“, weil das Kapitalmarktvertrauen heute auf der Annahme des Einsatzes nicht beschränkter Ressourcen der Europäischen Zentralbank, dauerhaft niedriger Zinsen sowie der ungebrochenen Unterstützung der wirtschaftlich erfolgreichen Länder der Währungsunion beruht.
Gute Gründe und falsche Wege
Ein „lernendes System“ kann sich selbstverständlich auch mit guten Gründen auf falsche Wege begeben. Die Euro-Diskussion wird derzeit als Derivat zweier Entwicklungen geführt. Die erste liegt in der neuen geostrategischen Konfrontation zwischen den USA und China, in der die Union in den Worten Präsident Macrons der Ambition „strategischer Autonomie“ Substanz zu geben sucht. Die zweite sind die wirtschaftlichen Implikationen der Pandemie, auf die die Europäische Union mit dem „Next Generation EU“ geantwortet hat.
Den Euro als einen wesentlichen Faktor für das geoökonomische Überleben der EU zu betrachten, ist sowohl naheliegend wie auch richtig. Neben der europäischen Handelspolitik ist der Euro derzeit das einzige „Pfund“, mit dem die Europäische Union global als ernstzunehmender Spieler auftreten kann. Er gibt ihr im globalen monetären System Gewicht, und er ist eine starke Indikation dafür, dass mit der EU als größtem Wirtschaftsraum der Welt auch politisch zu rechnen ist. Dazu kommt, dass die Welt der Währungen in Bewegung ist. Die Voraussage, dass der „decline of the dollar“ kurz bevorstehe, wird durch häufige Wiederholung zwar nicht richtiger. Richtig aber ist, dass das globale Finanzsystem mehr denn je von einer rationalen, weitblickenden und erfolgreichen Finanzpolitik der US-Regierung im Verein mit der Federal Reserve Bank abhängt. Und nachvollziehbar ist auch, dass die Strategie der US-Regierungen seit George W. Bush, im Zuge einer „weaponisation of the currency“ den Dollar in geostrategischen Konflikten zu instrumentalisieren, weitreichende Folgen hat. Es befeuert Chinas Bestrebungen nach einer größeren Reichweite der eigenen Währung, es veranlasste die russische Zentralbank zu einem massiven Abschmelzen von Dollar-Reserven, und es verleiht einem europäischen Diskurs Schwung, der von der EZB über den ESM bis zu den „Grünen“ im deutschen Bundestag eine Stärkung der internationalen Rolle des Euro als Königsweg heraus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit Europas zu betrachten scheinen. Allerdings übersieht dieser geoökonomische Optimismus, dass eine solche Ambition genau das voraussetzt, was der Euro-Raum bisher nicht hat, nämlich eine gemeinsame Vorstellung von Natur und Maß anzustrebender politischer Integration.
Dieses Defizit zeigt sich auch bei der europäischen Antwort auf die Covid- Krise. Sie folgt sowohl dem richtigen Impuls, der Notwendigkeit „europäischer Solidarität“, als auch der richtigen Analyse, nach der die Covid-Krise die wirtschaftlichen Asymmetrien innerhalb Europas auf ein nicht mehr tragbares Level zu treiben droht. Aber sie nahm ihren Ausgang mit einer Forderung von Europas Süden nach Streichung von sogenannten „Covid-Schulden“, als könne die Bekämpfung einer Gesundheitskrise und ihrer wirtschaftlichen Folgen nur durch einen finanzpolitischen Integrationssprung gelingen, mit dem alle Grundsätze aufgegeben würden, nach denen die Europäische Union und mit ihr der Euro-Währungsraum funktionieren. Der stattdessen ins Werk gesetzte „Recovery Plan“ ist an bisherigen Maßstäben gemessen sowohl ein großer Wurf, als auch ein kleinster gemeinsamer Nenner: Ein substantieller, auch Zuschüsse vorsehender, und mit Gemeinschaftsschulden finanzierter Transfer-Fonds für Strukturmittel, der jedoch als Einmal-Maßnahme konzipiert ist und mit dem daher keine langfristigen institutionellen Reformen der europäischen Finanzarchitektur einhergehen sollen. Und dennoch überschlagen sich die politischen Narrative: Der damalige deutsche Finanzminister Olaf Scholz schwärmte in Anlehnung an die Entstehung der amerikanischen Währungsunion von einem „Hamilton Moment“. Der ESM begrüßt die Vergrößerung des Pools an sogenannten „safe assets“ in Form der neuen Kommissions-Anleihen, die für das europäische Finanzmarktgeschehen tatsächlich wünschenswert sind, und manche Ökonomen beschwören den Durchbruch zu einer europäischen „Fiskal-Kapazität“ – in beiden Fällen schwingt hier die Erwartung einer Verstetigung dieses Instruments mit. Ohne Frage: Schon die Ankündigung des Fonds hat für Vertrauen in den europäischen Wirtschaftsraum gesorgt, und er kann auch durchaus einen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung und Modernisierung der Volkswirtschaften der EU leisten. Er ist jedoch keine institutionelle Reform, auch verlässt er nicht die ausgetretenen Pfade von europäischen Strukturhilfen, mit denen nationale Projekte finanziert, nicht aber genuine „europäische Güter“ geschaffen werden. Stattdessen ebnet er einer Transferunion den Weg, die in einer vertikalen Ausprägung eine besonders große Aussicht darauf hat, sich zu verstetigen.
Nicht „Next Generation Hamilton“, sondern Maastricht 3.0
Das Oszillieren der europäischen Debatte zwischen Erpressung, Vision, gutem Willen und pragmatischem Krisenmanagement ist nichts Neues. Aber der Euroraum ist nicht der Binnenmarkt, für den der Austritt Großbritanniens einen großen Verlust, aber keine Bedrohung darstellt. Er ist, wie die F. A. Z. den verstorbenen Ökonomen Henrik Enderlein aus dem Jahr 2016 zitiert, „inhärent instabil“.
Es ist erstaunlich, dass die mit der Covid-Krise noch einmal verschärften strukturellen Probleme der Eurozone zwar politische Energien aller Art freisetzen, aber keine überzeugende Initiative für einen neuen Reformansatz auslösen. Um der Finanzstabilität willen wurden 2007 eine deutsche Mittelstandsbank mit Steuergeld gerettet und wenige Jahre später Griechenland mit dreistelligen Milliardenbeträgen vor der Staatsinsolvenz bewahrt. Die derzeit von historisch niedrigen Zinsen geprägten Märkte scheinen zwar ein neues Toleranzlevel für die Höhe von Staatsschulden zu definieren. Auch spricht vieles dafür, dass die aktuellen Inflationsausschläge zunächst nicht von Dauer sein werden. Aber nichts spricht dafür, dass dieser Zustand anhält, noch dass er mit Konzepten wie einer Zinskurvensteuerung durch die Zentralbanken gegen einen unter Umständen auch plötzlichen Anstieg langfristiger Zinsen zu sichern wäre. In seiner Reaktion auf die Herabstufung Italiens durch die Ratingagentur Fitch im vergangenen April auf eine Stufe über „Sub-Investment Grade“ hat der damalige italienische Finanzminister noch enttäuscht darauf hingewiesen, die Ratingagentur habe die Unterstützung durch die Europäische Zentralbank nicht hinreichend gewürdigt. Wer den Fitch-Report vom Juli 2020 liest, muss sich fragen, wie das Rating ohne die Existenz des – inzwischen verlängerten – PEPP-Programms der EZB ausgefallen wäre.
Eine Abkürzung auf dem Weg zu einer wirtschaftlich erfolgreicheren und schockresilienten Währungsunion gibt es nicht. Die Debatte über eine potentielle Streichung von Schulden wird derzeit in Markt‑ und akademischen Zirkeln fortgesetzt. Eine nähere Analyse zeigt aber zweierlei: Eine „Streichung“ von Verbindlichkeiten innerhalb des Eurosystems würde auch von diesem bezahlt werden müssen, und bilanziell würde sie ein tiefes Loch in die Bilanz der EZB reißen. Es gibt hier kein „free lunch“, so attraktiv vermeintlich schmerzfreie Entlastungsmaßnahmen durch „financial engineering“ auch aussehen mögen. Das Operieren von Zentralbanken mit negativem Eigenkapital ist zwar nicht ohne Vorbild, für die Eurozone ist die Diskussion darüber aber eher eine große Ablenkung und dazu ein möglicherweise ungedeckter Wechsel auf das, was eigentlich neu verankert werden soll: Das Vertrauen in den Euro.
Der Schleier des angeblichen „Hamilton Moment“ verdeckt auch die Tatsache, dass die Euro-Reform-Debatte seit langem unter dem trügerischen Bemühen falscher Vorbilder leidet. Die Krise der Jahre 2011 und 2012 hätte durch eine europäische Bankenaufsicht sowie eine bessere Risikodiversifikation im Euroraum verhindert oder zumindest eingehegt werden können, nicht aber durch ein föderales Budget der Euro-Länder. Die stets erhobene Behauptung, der Euro-Raum benötige eine „Fiskalkapazität“ und müsse zu einer Fiskalunion ausgebaut werden, um stabil funktionieren zu können, geht auf eine konventionelle Betrachtung und ein ungenügendes Verständnis der Funktionsweise der US-amerikanischen Währungsunion zurück: In seiner Analyse für den Wirtschafts‑ und Finanzausschuss des europäischen Parlaments von 2017 zeigt der amerikanische Politikwissenschaftler Jonathan Rodden im Detail auf, dass die vielzitierten automatischen „fiscal stabiliser“ des US-Systems lediglich als Ausgleich für Mechanismen auf Ebene der Einzelstaaten wirken, die im Krisenfall ihrer Verpflichtung zu ausgeglichenen Haushalten in absolut kompromissloser Weise durch Ausgabensenkungen nachzukommen haben – unvorstellbar in einem föderalen System von demokratischen Staaten, denen ihr Haushaltsrecht heilig ist. Überdies kann bezweifelt werden, dass eine europäische Fiskalunion angesichts hoher Korrelationen konjunktureller Faktoren überhaupt eine wirkungsvolle antizyklische Stabilisierungsfunktion in Mitgliedsländern übernehmen könnte.
Der Weg zu einer nachhaltigen Governance der Eurozone muss von zwei Grundsatzbedingungen ausgehen: Weder werden der Euroraum oder gar die Europäische Union auf absehbare Zeit zu einem Bundesstaat. Noch würde eine Rückentwicklung zu einem Staatenbund eine hinreichende Basis für eine funktionierende Währungsunion bilden. Vielmehr bedarf es eines neuen Verständnisses davon, dass das komplexe System der europäischen Währungsunion sowohl mehr Integration als auch mehr Subsidiarität benötigt. Das „Mehr“ an Integration stärkt die Widerstands‑ und Wettbewerbsfähigkeit der Union durch Vertiefung der Binnenmärkte sowie eine wirkungsvollere Diversifizierung von Finanzrisiken. Das Konzept der Kapitalmarktunion ist dafür ein guter Anfang. Wenn Kapitalmärkte besser verzahnt und Anlage‑ und Investitionsrisiken auf den Währungsraum verteilt sind, entwickeln sich „shock absorber“, die in einem integrierten Wirtschafts‑ und Finanzraum wie den USA nach Schätzungen bis zu 50 % von Risiken auffangen können. Ein echter, durch den Abschluss der Bankenunion ermöglichter Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen, höhere Arbeitsmarktmobilität, ein größerer Anteil von grenzüberschreitenden Direktinvestitionen sowie kapitalbasierte Altersvorsorge und alles, was den Euroraum wirtschaftlich produktiver macht, gehören dazu.
Das „Mehr“ an Subsidiarität ist in erster Linie eine institutionelle Absicherung dessen, was den Kern der Maastricht-Idee ausmacht: Die Mitgliedstaaten sind gemäß der „No-Bail-Out“ Klausel für ihr finanzielles Handeln selbst verantwortlich. Der sogenannte „Fiscal Compact“ ist der Versuch, das jeder Währungsunion inhärente „Moral Hazard“ Problem in Form von Regeln und Kontrollen zu minimieren. Wo aber keine Strukturen und glaubwürdige Mechanismen existieren, um Regeln auch durchzusetzen, besteht eine Systemgefährdung durch Fehlanreize. Wohldurchdachte Vorschläge für solche Mechanismen liegen seit Jahren auf dem Tisch. Mit ihnen würde der ESM von einem Stabilisierungs‑ zu einem europäischen Währungsfonds ausgebaut, der klare Regeln für den Fall von Liquiditats‑ und Solvenzkrisen von Mitgliedsländern vorsieht, die sich an jene des IMF anlehnen. Als unmittelbare Konsequenz wäre mit diesen auch der bisher ungelöste „Banken/Sovereign-Nexus“ aufzubrechen, also die hohe Anfälligkeit des Finanzsystems aufgrund der wechselseitigen Risiken, die mit dem hohen Anteil, den Banken in Europa an den Staatsanleihen ihres jeweiligen Heimatlandes halten, einhergehen. Die Auflösung dieses Wirkzusammenhangs ist eine für die Staatsfinanzierung in Europa unbequeme, aber zwingende Maßnahme, wenn der Euroraum es mit den Zielen von Finanzstabilität und Krisenresilienz ernst meint.
In Folge des zögerlichen und widersprüchlichen Verfahrens in der Krise um Griechenland hat die Bundesregierung seinerzeit durchgesetzt, dass Staatsanleihen im Euroraum mit sogenannten „Collective Action Clauses“ ausgestaltet werden, die regeln, mit welchen Mechanismen sich Anleger gegen die Umstrukturierung von Staatsanleihen zur Wehr setzen können, und die umgekehrt den Handlungsspielraum von Staaten definieren, wenn sie im Zuge einer Umschuldung von Staatsschulden mit Anlegern über eine Verlustbeteiligung verhandeln. Diese Regeln führen bisher in der Governance der Eurowelt als zarte Pflänzchen eines neuen Denkens ein sehr einsames Dasein. Mit den Vorschlägen für einen effektiven europäischen Währungsfonds, erstmalig prominent von dem damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 2010 in der Financial Times vertreten, wurde es Teil einer Reformlogik, die mit den sogenannten „Bail-in“-Regeln für unbesicherte Bankanleihen ihren seinerzeit so zwingenden wie mutigen Anfang genommen hat. Nach diesen Regeln können nicht nur die am Eigenkapital beteiligten Anleger an Verlusten von Banken partizipieren, sondern auch die Inhaber von unbesicherten und rückzahlbaren Schuldtiteln. Angesichts der Anfälligkeit des Finanzsystems für Bankenkrisen galt die unbesicherte Bankanleihe lange wie auch die Staatsanleihe als ein sakrosankter Baustein des Finanzsystems, für den im Zweifel die Steuerzahler in Haftung zu nehmen waren. Heute hat der Finanzmarkt den ursprünglich revolutionär anmutenden Regimewechsel, 2008 von den G20 in Gang gesetzt, vollständig verarbeitet. Transparente und hinreichend lange Fristen zu ihrer Einführung sowie ein günstiges Kapitalmarktumfeld waren wesentliche Erfolgsfaktoren, die heute in der Welt der Euro-Staatsanleihen analoge Anwendung fänden. Perfekt sind die Bail-In Regeln für Banken noch nicht, ihre Umsetzung in Europa ist uneinheitlich. Aber ein Anfang ist gemacht. Übertragen auf die Euro-Governance würde das bedeuten, dass Kapitalanleger wie auch politische Entscheidungsträger betroffener Länder mit der konkreten Möglichkeit einer Beteiligung des Kapitalmarktes an Krisenkosten zu rechnen haben. In der Sache nichts anderes als die Konkretisierung des „No-Bail-Out“ Prinzips von Maastricht, würde dessen Institutionalisierung die Debatte in den Mitgliedsländern fokussieren helfen: Auf die primäre Zuständigkeit und Verantwortung für das Vertrauenskapital bei Wählern, Partnern und Wirtschaftsakteuren, das aus weitsichtigem und verlässlichem Staatshandeln resultiert.
Gerne wird Verfechtern einer stärker marktorientierten Governance Argentinien mit seinen vielfach gescheiterten Umschuldungen als abschreckendes Beispiel vorgehalten. Aber inwiefern gleicht Argentinien den Mitgliedsländern der Eurozone? Das Konzept einer Staatsanleihe aus einem Währungsraum, der den Anspruch hat, politisch und wirtschaftlich eine verlässliche und führende Rolle einzunehmen, schließt selbstverständlich ein, dass Anleger das in solche Staatsanleihen investierte Geld auch zurückbekommen. Doch die Europäische Union ist beides: führend und verlässlich, aber auch politisch unfertig. Deshalb muss man sich mit der Frage der Möglichkeit von Restrukturierungen von Staatsanleihen befassen. Selbst in den USA kann sich die Notwendigkeit ergeben, solche Instrumente einzusetzen; wer das vertiefen möchte, befasse sich beispielsweise mit den fortgesetzten Auseinandersetzungen um die Finanzen des Staates Illinois. Die Eurostaaten sind integrierte Mitglieder der Europäischen Union und Empfänger substantieller Strukturhilfen, werden nach Einschätzung vieler von einer zu weitreichend agierenden Zentralbank von Marktrisiken abgeschirmt, und können im Krisenfall auf Stabilisierungsmittel zurückgreifen, sofern sie die Grundregeln von Konditionalität bereit sind zu respektieren. Ein europäischer Währungsfond würde nicht den Kapitalmarkt und mit ihm die sogenannten „Bond Vigilants“, also aktive und durch ihr Handeln die Risiken von Staatspapieren transparent machende Anleger, als neue Herren über das Finanzschicksal ihrer Mitglieder installieren. Er würde vielmehr eine Balance herstellen helfen, mit der politische Zentralinstitutionen innerhalb der europäischen Währungsunion vorerst überfordert sind.
Die Reformenergie, die für einen solchen Weg erforderlich wäre, sollte schließlich noch drei weitere Schritte vorsehen, um das „lernende System“ Europäische Union für die nächsten Jahrzehnte im Sinne eines „Maastricht 3.0“ richtig aufzustellen: Erstens eine Stärkung dezentraler Governance im Rahmen der regionalen „Fiscal Boards“, die die Arbeit des Fiscal Compacts unterstützen, sowie die Vereinfachung der Haushaltsüberwachung mit Hilfe einer einfachen Schuldenregel.9 Zweitens eine Ausrichtung der EU-Finanzen auf originäre „öffentliche Güter“ wie Grenzschutz, Sicherheit und Verteidigung, Forschung und europäische Infrastruktur. Und drittens den Abschluss der Bankenunion.
Das deutsche Interesse
Aus deutscher Perspektive lässt sich vordergründig mit dem Status quo „fuzzy and fragile“ besser leben, als es gemeinhin wahrgenommen wird. Dass wir einen deutlich höheren Wechselkurs in Kauf nehmen müssten, wenn wir nicht den Euro hätten, ist inzwischen zu einem deshalb nicht falschen Allgemeinplatz geworden. Aber finanziell profitiert Deutschland ebenso davon, dass die deutsche 10-Jahresanleihe, der „Bund“, den Status eines „sicheren Hafens“ für den Währungsraum hat. Dank eines komplexen Zusammenspiels von diesem „safe haven“-Status mit Liquiditätspräferenzen des Marktes sind insbesondere seit Beginn der Finanzkrise 2008 nirgendwo in Europa die Finanzierungsbedingungen so attraktiv wie in Deutschland. Aber was den Status quo charakterisiert, akzentuiert sich noch, wenn es krisenhafte Zuspitzungen im Euroraum gibt. Als die Conte/Salvini-Regierung im Oktober 2018 bewusst die europäischen Haushaltsregeln verletzte und Matteo Salvini einmal mehr Europa den Kampf ansagte, verdreifachten sich die Risikoaufschläge für Renditen für italienische Staatsanleihen. Der Kapitalmarkt trug so das Seine dazu bei, dass die italienische Regierung schließlich einlenkte. Internationale Anleger schauen in solchen Situationen nicht nur auf die italienische Anleihe selbst, sondern auch auf deren sogenannten „Spread“ zu den deutschen 10–Jahresanleihen, als relevanten Krisenindikator. Diesen könnte man auch als eine Art „Euro-Fieberthermometer“ beschreiben, dessen Stand sich rasant erhöhen kann. Denn was den wenigsten bewusst ist: In den meisten dieser Fälle von krisenhaften Zuspitzungen verhält sich der Bund gegenläufig zur Italien-Anleihe, so dass die Höhe des Thermometers nicht nur durch steigende italienische, sondern auch durch fallende deutsche Zinsen getrieben wird. Wären die Deutschen Finanzspekulanten, könnten sie an diesem fragilen Zustand der Währungsunion also durchaus Gefallen finden. Aber ratsam ist es nicht. Denn die Kosten eines Auseinanderbrechens der Währungsunion übersteigen sicherlich die Höhe der vielzitierten „Target-Salden“, die die Bundesbank als größten Gläubiger des Eurosystems ausweist. Deutschlands wirtschaftliches Gewicht und seine politische Verantwortung sind die einer europäischen Führungsmacht – eine Aufgabe, die sich weder zurückweisen lässt, noch kostenlos wahrzunehmen ist. Der mit Frankreich ins Werk gesetzte europäische Wiederaufbaufonds ist Ausdruck davon. Leider wurde er ohne Verbindung mit einer weitreichenderen Vorstellung von einer tragfähigen institutionellen Reform der Europäischen Währungsunion ins Werk gesetzt. Dies ist vielleicht das verständliche Ergebnis besonderer Umstände. Nun aber ist es Zeit, nachzuarbeiten.
Der komplette Text als pdf >
Author
-

Martin Wiesmann ist Mit-Gründer und sitzt dem Beirat von R21 vor. 2022 initiierte er gemeinsam mit Professor Weimann den unabhängigen Expertenrat Klima und Energie von R21. Nach politik- und betriebswissenschaftlichen Studien in Bonn, Paris und Pittsburgh war er 30 Jahre in der Finanzindustrie tätig, zuletzt als Vice Chairman Investment Banking Europe, Middle East and Africa von J.P. Morgan. Seit 2020 war er u. a. Senior Associate Fellow der Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) für Geoökonomie und arbeitet heute als Managing Partner der Beratungsgesellschaft für internationale Government Affairs und Geopolitik, Berlin Global Advisors. Wiesmann ist Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE, Düsseldorf, sowie u. a. Mitglied der Atlantik-Brücke und Alumnus der Baden-Badener Unternehmer Gespräche. Zudem ist er in den Kuratorien des Literaturhauses, des Städelmuseums und der Schirn in Frankfurt sowie der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt aktiv.
Alle Beiträge ansehen