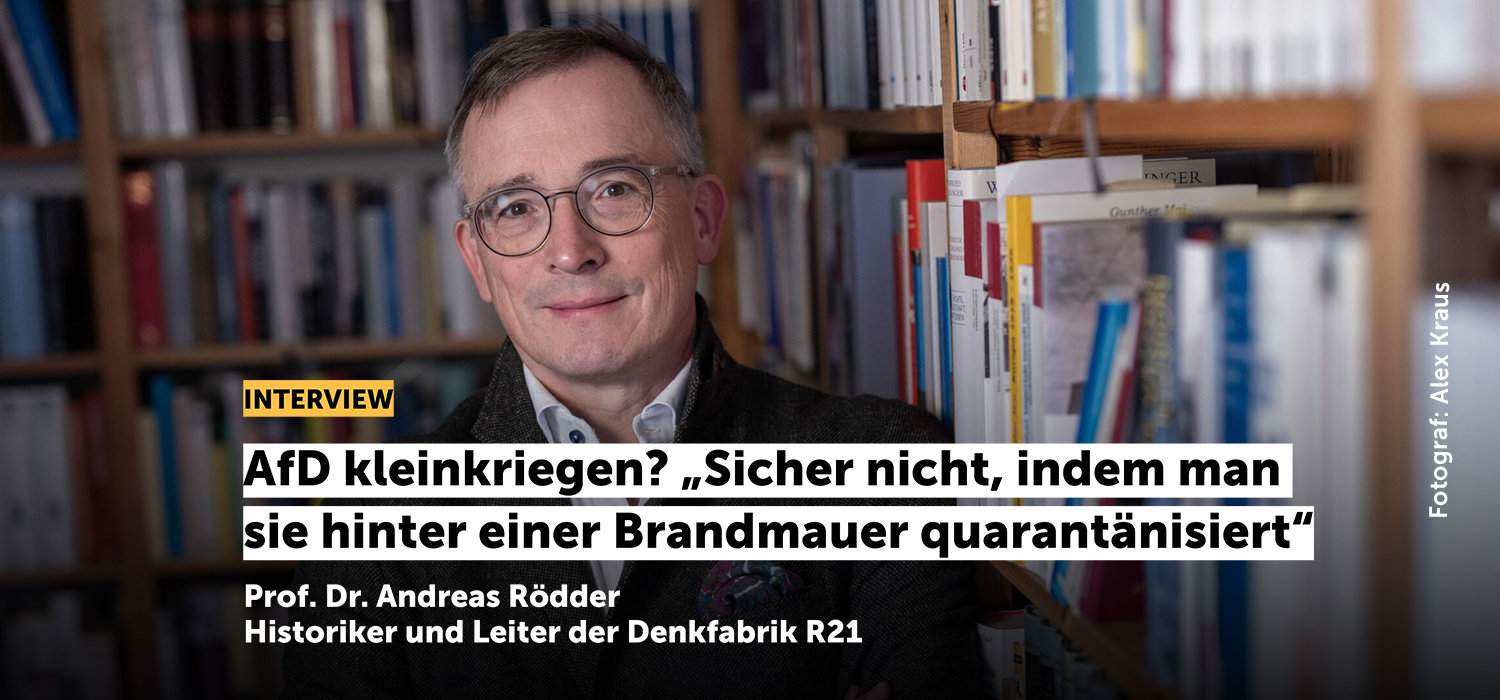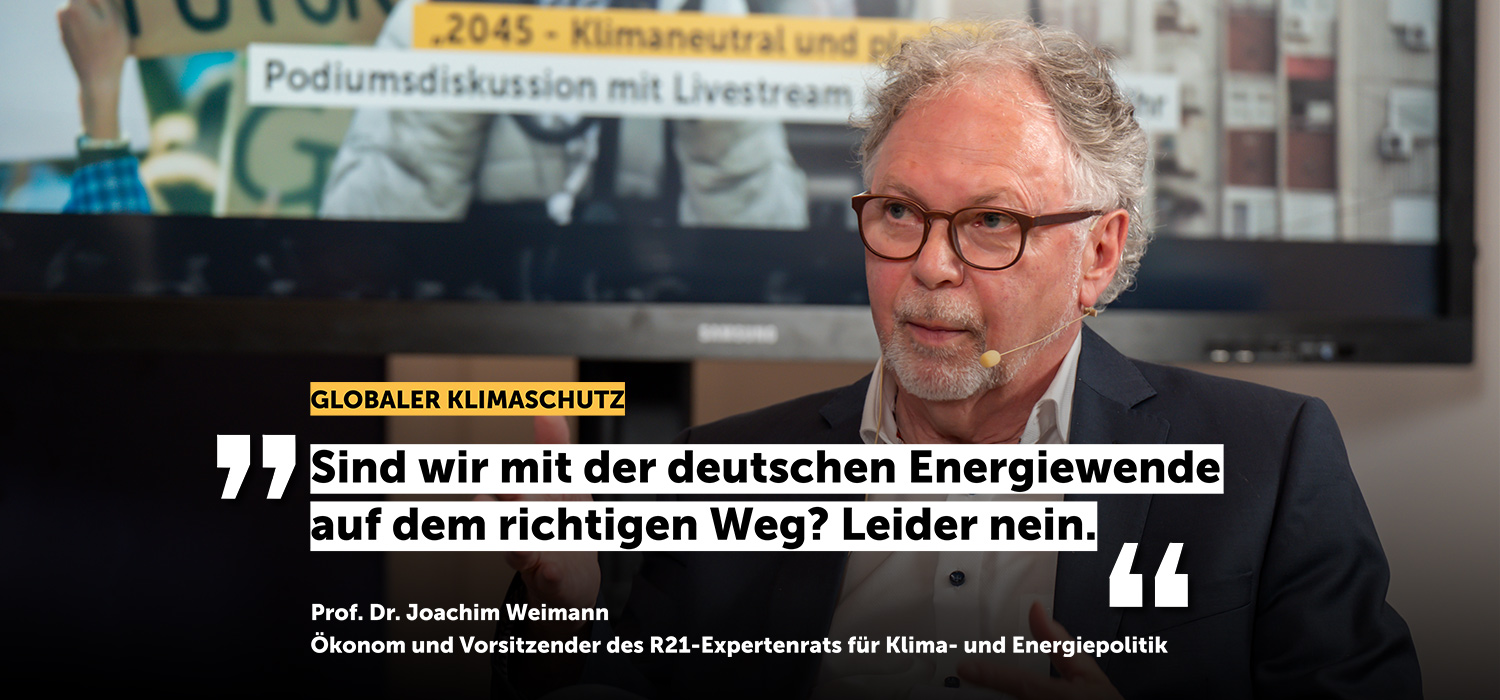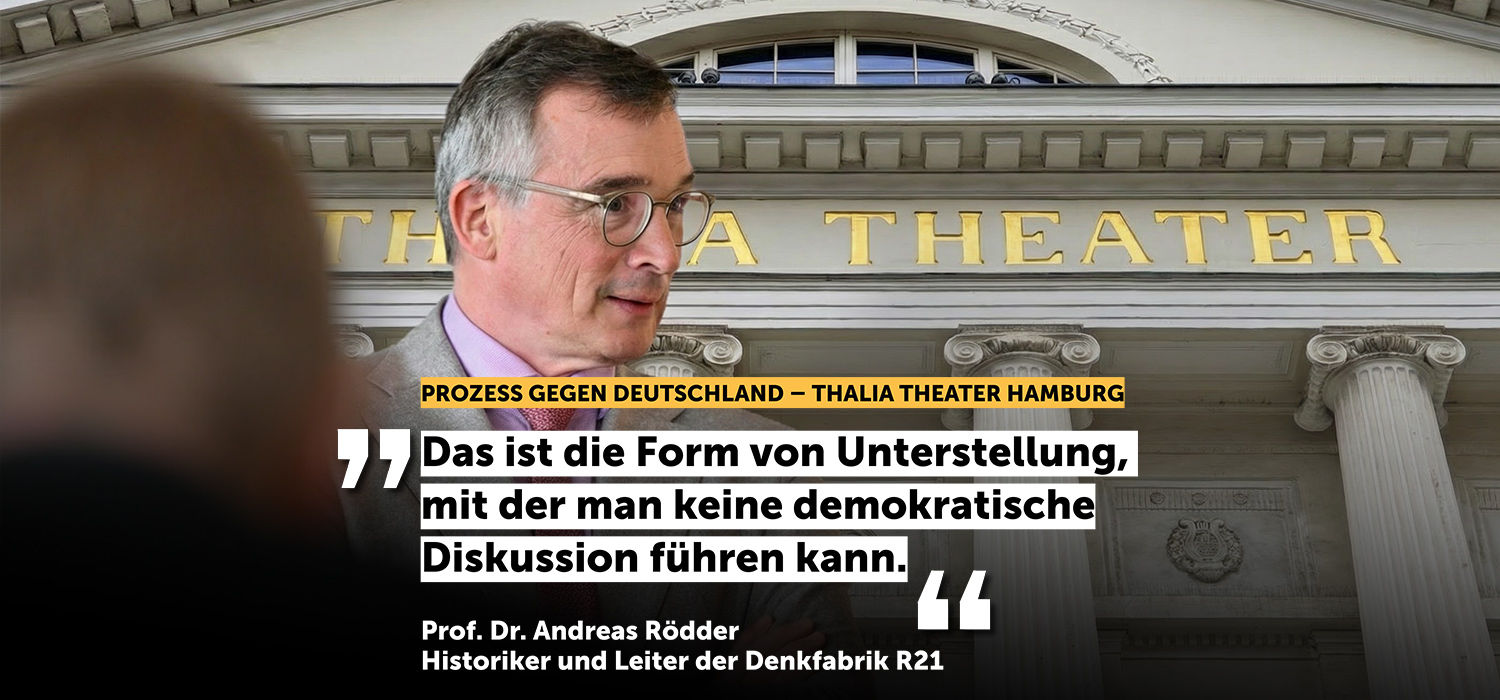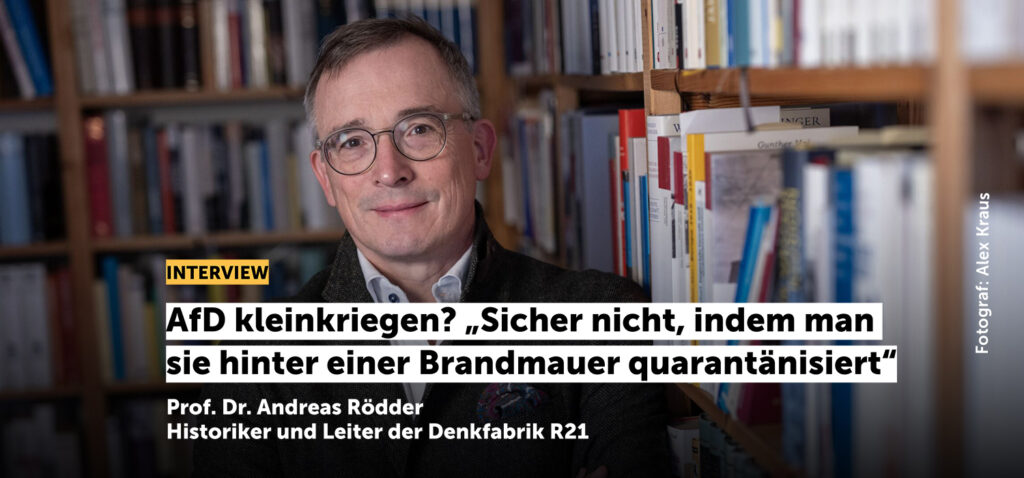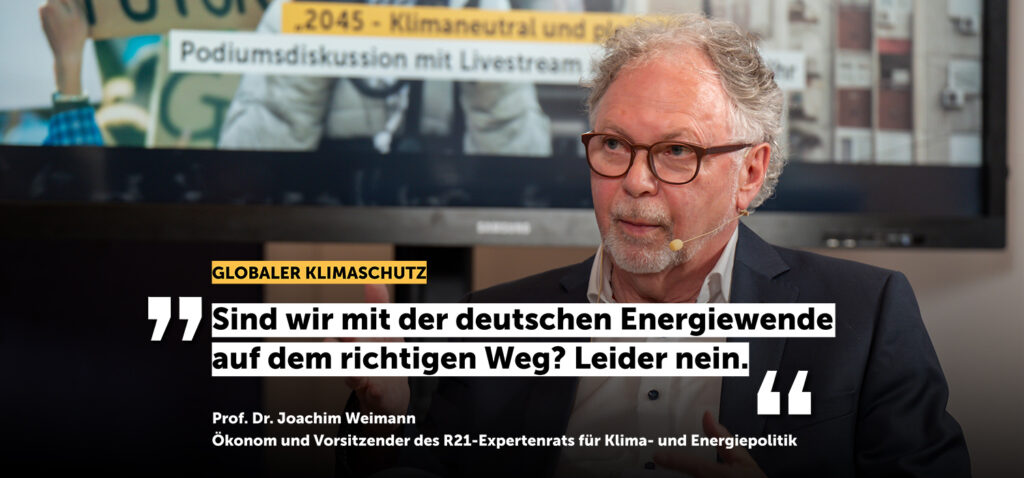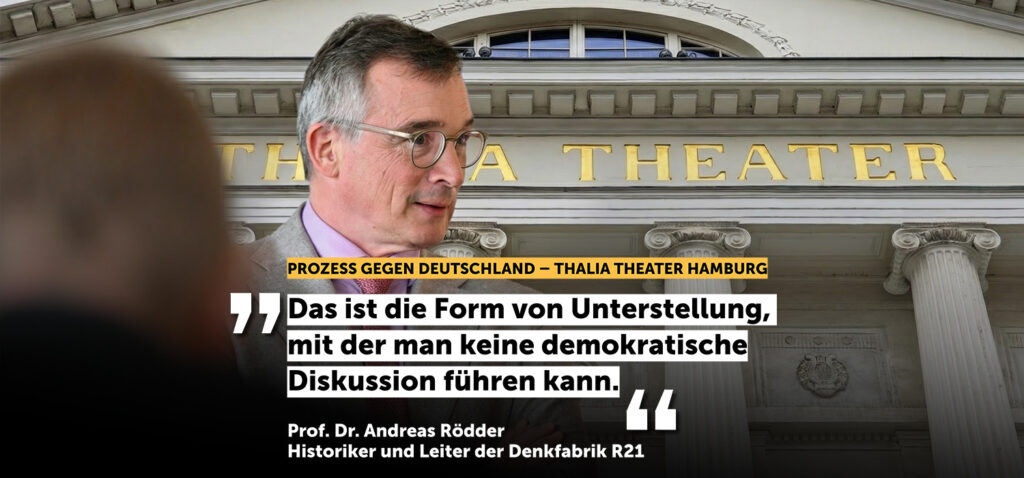Bei dem von Barbara Zehnpfennig stammenden Text handelt es sich um die schriftliche Fassung eines am 9.10.25 als RHI-Lecture (Roman Herzog Institut) gehaltenen Vortrags.
1. Gerechtigkeit
Bei Betrachtung der aktuellen Weltlage offenbart sich eine, wie es scheint, historisch einmalige Anhäufung schier unlösbarer Probleme. Die Gewichte in der Welt verschieben sich, von skrupellosen Diktatoren beherrschte Staaten wie Russland, China, Iran und Nordkorea drohen zu Bündnissen zu finden, die den demokratischen Staaten gefährlich werden können. Innerhalb der demokratischen Staaten schreitet die politische Polarisierung voran, was sich auf die Stabilität der politischen Ordnung auswirken kann. Selbst die Vorzeigedemokratie USA ist offensichtlich ins Schlingern geraten, und ihre neue Distanz zu Europa schwächt den „Westen“, der nicht nur von Autokratien, sondern auch vom international agierenden Islamismus in Frage gestellt wird. Russlands Überfall auf die Ukraine ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und hat den Krieg zurück nach Europa gebracht, was alte Sicherheiten erschüttert. Im Nahen Osten wächst der Hass zwischen Israelis und Arabern unaufhörlich, und es ist absehbar, dass er sich über viele Generationen hinweg fortpflanzen wird; eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.
Zusätzlich zu diesen keineswegs in Gänze dargestellten Unwuchten in der Weltordnung gibt es zahlreiche globale Herausforderungen, die zur Bewältigung anstehen. Wie kann man den von Menschen verursachten Anteil an der Erderwärmung reduzieren? Findet man zu einer sachgerechten Regelung der Migration? Dürfen Staaten wirtschaftlichen Protektionismus betreiben und damit den Freihandel einschränken? Wie geht man mit dem Erbe des Kolonialismus um? Haben reiche Staaten eine Bringschuld gegenüber armen Ländern? Muss man nicht für einen Ausgleich sorgen, wenn manche Staaten von extremer Ressourcenknappheit, etwa was die Wasserversorgung angeht, betroffen sind?
Diese und viele andere Fragen stellen sich im internationalen Rahmen, und der Gesamteindruck, den viele haben, ist, dass es in der Welt ungerecht zugeht. Die Starken setzen sich durch, die Schwachen werden unterdrückt. Die Natur hat die Länder mit ungleichen Ressourcen ausgestattet, die Menschen haben die Ungleichheit durch ihr Agieren verschärft. Gerechtigkeit, so scheint es, ist weder in der Natur noch im Zusammenwirken der Menschen und Staaten zu finden. Was die Realität bestimmt, ist nichts weiter als eine Reihe von Defiziten.
Diese düstere Diagnose ist naheliegend, aber ist sie auch berechtigt? In ihr ist vorausgesetzt, dass man weiß, was gerecht ist und Ungerechtigkeit somit zweifelsfrei identifizieren kann. Und ist Gerechtigkeitsempfinden nicht tatsächlich eine natürliche Ausstattung des Menschen? Haben nicht schon kleine Kinder ein untrügliches Gefühl dafür, wenn es ungerecht zugeht? Dass der Mensch von klein auf eine Empfindsamkeit für zwischenmenschliche Beziehungen hat, die sich in einer Schieflage befinden, weil sie zum Nachteil einer Seite ausschlagen, lässt sich sicherlich nicht leugnen. Ob sich darin aber schon ein Wissen darum, was gerecht ist, ausdrückt, darf man dennoch bezweifeln. Denn was ist gerecht?
Auf diese Frage hat jeder eine Antwort, und diese Antworten unterscheiden sich gewaltig. Wenn der eine es für gerecht hält, dass man in puncto Migration die Grenzen offenhalten sollte, sieht der andere darin eine große Ungerechtigkeit gegenüber denen, die die Folgen der Migration tragen müssen. Hält der eine das Gendern für die Verwirklichung einer „geschlechtergerechten Sprache“, so vertritt der andere die Auffassung, dass ein solcher Eingriff in die Sprache nicht Ausdruck von Gerechtigkeit, sondern von Übergriffigkeit ist. Befürwortet der eine die Höherbesteuerung von Erbschaften und hohen Einkommen als gerechte Bereinigung gesellschaftlicher Ungleichheit, so erscheint das dem anderen als unfaire Benachteiligung von Leistungsträgern und als nur mühsam kaschierter Sozialneid. Man wird bei allen Fragen von gesellschaftlicher Relevanz stark divergierende Einschätzungen darüber antreffen, was eine gerechte Regelung wäre – genauso, wie man sich im privaten Bereich keineswegs darüber einig ist, was gerecht, was ungerecht ist.
Das ist ein Anlass zum Staunen. Da doch alle wissen, was gerecht ist – wissen sie da Verschiedenes? Oder gibt es davon gar kein wirkliches Wissen, sondern nur ein Meinen? Doch das scheint auch keine Lösung zu sein. Niemand, der sich ungerecht behandelt fühlt, würde sich damit begnügen, wenn der, von dem er Unrecht zu erleiden glaubte, seinerseits bekundete, korrekt, nämlich seinem Gerechtigkeitsverständnis gemäß gehandelt zu haben. Für sich selbst zumindest möchte jeder die wahre Gerechtigkeit, nicht bloß eine subjektiv so empfundene. Warum aber hält man die eigene Gerechtigkeitsvorstellung für zutreffend und nur die des anderen für subjektiv? Das ist wohl auf den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeitsempfinden und Interesse zurückzuführen.
2. Zwei Modelle der Gerechtigkeit
Mit der Gerechtigkeit ist es so ähnlich wie mit der Vernunft: Man neigt dazu, das für vernünftig zu halten, was mit der eigenen Einstellung übereinstimmt. Wahrhaft gerecht ist dann analog, was unserem Gerechtigkeitsverständnis entspricht. Und dieses Verständnis ist wiederum oft genug geprägt von unseren Interessen. Dabei spielt es eine Rolle, ob man sich in einer starken oder schwachen Position befindet. Als Unterlegener plädiert man gern für eine Gleichbehandlung, als Überlegener für eine Ungleichbehandlung. Im ersten Fall verbessert man seinen Status, im zweiten Fall bewahrt man ihn zumindest.
Schaut man in die Ideengeschichte und die politische Geschichte, wird man diesen beiden Grundverständnissen, was gerecht ist, immer wieder begegnen. Gerechtigkeit ist Gleichheit, Gerechtigkeit ist Ungleichheit. Das wird zwischenmenschlich angewendet, innergesellschaftlich und zwischenstaatlich. Einheiten, die sich als Gleiche verstehen, setzen dabei auf Bündnisse, Einheiten, die sich als ungleiche wahrnehmen, auf den Durchsetzungskampf.
Das ist auch die Situation, die weltpolitisch gerade wahrzunehmen ist. Vor allem die demokratischen Staaten, die auch innergesellschaftlich auf Gleichheit abonniert sind, machen internationale Verträge, internationale Bündnisse etc. geltend. Autokratien, bei denen schon innerhalb der Gesellschaft massiv Ungleichheit praktiziert wird, setzen sich über internationale Vereinbarungen hinweg und wenden das Recht des Stärkeren an. Und wenn sie untereinander Bündnisse schmieden, dann zuungunsten Dritter und nur so lange, wie sie sich allein nicht wieder stärker fühlen. Unsere Sympathien als Demokraten gelten eindeutig der ersten Variante, die auf Gleichheit setzt. Man muss sich aber klar machen, dass beide Varianten die Gerechtigkeit für sich in Anspruch nehmen, und beide aus guten Gründen. Das soll an zwei Beispielen aus der Antike verdeutlicht werden. Das erste ist dem Dialog „Protagoras“ von Platon entnommen, das zweite dem Werk „Der Peloponnesische Krieg“ des griechischen Geschichtsschreibers Thukydides.
In Platons gleichnamigem Dialog erzählt der Sophist Protagoras eine Schöpfungsgeschichte. Danach wurden am Anfang der Zeiten die Lebewesen mit den Fähigkeiten versehen, die ihnen das Überleben sichern, z. B. Zähne, Klauen, ein Fell. Den Menschen hatte man bei der Verteilung der Gaben jedoch vergessen. So war sein Überleben nur zu gewährleisten, indem man ihm als Ersatz für das fehlende körperliche Rüstzeug die Weisheit der Athene und die Handwerkskunst des Hephaistos verlieh. Dadurch konnten die Menschen mit künstlichen Mitteln, mit Verstand und Technik, erreichen, was den Tieren durch ihre natürliche Ausstattung gelang, nämlich sich selbst zu erhalten. Doch die Menschen gefährdeten ihr Überleben wieder, indem sie einander Unrecht taten. So griff am Ende Zeus ein und schenkte ihnen Scham und Recht, was wohl bedeuten soll: Er gab ihnen die innere Bereitschaft und das äußere Regelsystem, um das wechselseitige Unrecht-Tun zu beenden.
Protagoras betont, dass jeder Mensch diese Gaben bekam. Er insistiert also auf die Gleichheit. Und damit ist, wie Platon auch in anderen Dialogen andeutet, das Prinzip des Vertrags begründet. Die untereinander Gleichen verpflichten sich wechselseitig, die Regeln einzuhalten, bspw. die Rechte des anderen zu achten – in der Erwartung, dass einem selbst das ebenfalls widerfährt. Gerechtigkeit ist „Wiedergeben, was man empfangen hat“, sagt der greise Kephalos in Platons „Politeia“, und bei dieser Figur wird das Motiv für das genannte Gerechtigkeitsverständnis deutlich: Den eigenen Besitz zu erhalten, gelingt nur, wenn man den des anderen nicht antastet. Es ist durchaus ein Eigennutzkalkül, eine Überlebensstrategie, die Gleichheit als gerecht zu propagieren. Man schützt sich so vor einer Ungleichheit, deren Opfer man werden könnte.
Nun zu der entgegensetzten Gerechtigkeitsvorstellung. Im berühmten Melierdialog aus dem „Peloponnesischen Krieg“ von Thukydides reden die Athener mit den Bewohnern der Insel Melos, welche von den Athenern belagert wird. Die Athener als die Aggressoren wollen die Melier zur Kapitulation zwingen, bieten aber ein Gespräch an. Die Melier mutmaßen, was das Ergebnis des Gesprächs sein wird: bei freiwilliger Unterwerfung Knechtschaft, bei Weigerung Krieg. Dennoch wollen sie sich auf die Verhandlungen einlassen, um sich nicht vorwerfen lassen zu müssen, sie hätten nicht alles zum Erhalt ihrer Polis getan.
Ihren Standpunkt machen die Athener schnell klar: Recht gilt nur bei Gleichheit der Kräfte, bei Ungleichheit aber setzt der Überlegene sich gegen den Schwächeren durch. Das Recht weicht der Macht; das steht für die Athener außer Zweifel. Alles, was die Melier dagegen geltend machen, wird von den Athenern abgeschmettert. Was ist, wenn ihr selbst einmal die Schwächeren seid? Davor ist uns nicht bang; lasst das unsere Sorge sein. Und wenn wir euch Neutralität bzw. Freundschaft anbieten? Freundschaft ist ein Zeichen von Schwäche. Was aber, wenn diejenigen, die bisher noch keinem Bündnis angehören, sich gegen euch zusammenschließen, aus Furcht, ihnen könnte dasselbe widerfahren wie uns? Freie Staaten, so die Athener, tun sich schwer, zu irgendwelchen Entschlüssen zu gelangen, selbst zu solchen, die der Abwehr des Feindes gelten.
Neben diesen uns durchaus bekannten Einschätzungen machen die Athener aber letztlich eines geltend: Wenn die Melier sich auf die Gunst der Götter berufen, die ihnen als den Unrecht-Leidenden doch zur Seite stehen werden, dann können sie, die Athener, das ebenfalls. Denn dass derjenige, der stark ist, auch herrscht, ist ein Naturgesetz, das von Göttern wie Menschen exekutiert wird. Sie, die Athener, haben dieses Gesetz nicht erfunden; vielmehr ist es ein vorgefundenes und immer gültiges. Mit anderen Worten: Gegen das Recht, das die Gleichen sich selbst geben, setzen die Athener das Recht, das die Natur dem Stärkeren verleiht. Was die Gerechtigkeit angeht, beziehen sich die Athener nach ihrem Verständnis also auf etwas viel Gewichtigeres als die menschliche Übereinkunft: auf ein göttliches Gesetz bzw. das der Natur. Dieses wenden sie in der Folge auch mit dem besten Gewissen der Welt an. Die Melier wollen sich nicht beugen und wählen den Kampf, den sie verlieren. Nach dem Sieg über sie bringen die Athener alle männlichen Einwohner um, Frauen und Kinder verkaufen sie in die Sklaverei, und die Kultur der Melier löschen sie aus, indem sie die Insel mit ihren Bürgern neu besiedeln. Das also ist die Außenpolitik des demokratischen Athen.
3. Zentrale Herausforderungen im internationalen Rahmen
Mit den eben präsentierten beiden Gerechtigkeitsmodellen sollte gezeigt werden, dass sowohl das Gleichheitskonzept als auch das der Ungleichheit auf der Verfolgung partikularer Interessen beruhen kann und dass dennoch beide, eben auch gegeneinander, die Gerechtigkeit für sich in Anspruch nehmen. Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass Gerechtigkeit mehr sein muss als Gleichheit oder Ungleichheit, zumal eine unterschiedslose Gleichbehandlung aller ebenso fragwürdig ist wie die umgekehrte Version. Gerechtigkeit könnte also damit zu tun haben, unterscheiden zu können, wann Gleichbehandlung und wann Ungleichbehandlung angemessen ist. Was bedeutet das für die Gerechtigkeit im internationalen Rahmen?
Die Weltgemeinschaft ist tendenziell darum bemüht, mittels des Rechts eine gerechte Weltordnung zu schaffen. Es ist der Versuch, Gerechtigkeit in Rechtsform zu gießen. So gibt es eine Vielzahl von rechtlichen Bestimmungen, die über den Nationalstaat hinausweisen, z. B. das humanitäre Völkerrecht, die Menschenrechte, das internationale Strafrecht, das Seerecht usw. Außerdem sollen internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, der Internationale Währungsfonds etc. dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Staaten regelbasiert und Friedens-, Sicherheits- und Wohlstands-orientiert stattfindet. Hier aber steht man vor mindestens zwei großen Problemen.
Das erste ist das genannte: Die Vorstellungen davon, was gerecht und somit auch rechtens ist, unterscheiden sich deutlich. Für islamische Staaten z. B. sind die vom Westen propagierten Menschenrechte keineswegs universell. Sie haben eine eigene Menschenrechts-Charta (Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam), in der der Scharia Vorrang vor allen menschengemachten Gesetzen eingeräumt wird. Dass alle Menschen gleich sind, ist hier nicht vorgesehen. Vielmehr werden Männer und Frauen, Gläubige und Ungläubige als Ungleiche behandelt.
Das zweite Problem betrifft die Verbindlichkeit des Rechts. Innerhalb eines Staates werden die Normen und Regeln von der Regierung festgelegt und durchgesetzt. Auf der globalen Ebene gibt es dazu bekanntlich kein Pendant, wir haben keine Weltregierung. Insofern kann Regel- bzw. Rechtskonformität nicht erzwungen werden. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stellt fest, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt, und fordert eine friedliche Beilegung des Konflikts? Das interessiert Russland nicht, es nimmt ein höheres Recht für sich in Anspruch – das Recht, sich zu nehmen, was man haben will, wenn man stark genug ist, es auch zu bekommen. Man versucht auf internationaler Ebene, Russland durch Sanktionen zu schwächen und damit an den Verhandlungstisch zu bringen? China und Indien kaufen weiterhin das nun deutlich billigere russische Öl; ihre Interessen wiegen schwerer als die Solidarität mit der Gemeinschaft.
Und das kennzeichnet die Gesamtlage: Die Vorstellungen, was gerecht ist, gehen auseinander. Selbst, wenn mehrheitlich etwas als Recht fixiert wird, lässt sich dessen Durchsetzung nicht erzwingen. Überall kommen Interessen ins Spiel oder werden zumindest unterstellt – auch dabei, was als rechtens definiert wird. Deshalb scheint es im globalen Rahmen noch schwieriger als innergesellschaftlich, Gerechtigkeit zu üben. Zu der Frage, was überhaupt gerecht ist, gesellt sich das Problem, wie man das verbindlich machen kann, worauf man sich zumindest mehrheitlich geeinigt hat.
Das könnte man nun an vielen Themen durchdeklinieren. Nehmen wir die Frage der Migration. Zur rechtlichen Regelung der Migration gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention, den Globalen Migrationspakt, das Migrations- und Asylpaket der EU, das deutsche Asyl- und Aufenthaltsrecht und vieles andere mehr. Doch welche Verteilung der Migranten ist gerecht? Naheliegend wäre hier eine Ungleichbehandlung: Die großen und wirtschaftlich starken Länder müssen auch mehr Migranten aufnehmen. Ist aber alleine die Wirtschaftskraft ausschlaggebend, oder kann die Aufnahmefähigkeit eines Landes nicht auch durch zu starke kulturelle Differenzen eingeschränkt sein? Wer ist eigentlich Objekt der Gerechtigkeit? Nur die Migranten oder auch die einheimische Bevölkerung? Kann es nicht eine Kollision der Werte geben, etwa wenn der Wert der Gerechtigkeit mit dem der Sicherheit konfligiert? Und ist nicht auch die Armutsmigration berechtigt, da es doch eine fundamentale Ungerechtigkeit darzustellen scheint, dass Menschen in manchen Weltregionen so geringe Lebenschancen haben und in anderen derart vielfältige?
Jenseits der rein rechtlichen Perspektive stellen sich also zahlreiche über sie hinausweisende Fragen, abgesehen davon, dass auch die praktische Umsetzung des Rechts eine große Herausforderung darstellt. Und selbst, wenn sich eine Staatengemeinschaft wie die EU prinzipiell auf Regelungen geeinigt hat, ist nicht gesagt, dass alle Partner des Bündnisses mitziehen. In der EU ist fortwährend zu beobachten, wie nationale Egoismen dazu führen, dass gemeinsame Beschlüsse unterlaufen werden oder gar nicht erst zustande kommen.
Das trifft – ein anderes Beispiel – ebenfalls auf das globale Problem der Erderwärmung zu. Aus dem Pariser Klimaabkommen, das die Staaten der Welt völkerrechtlich zu gemeinsamen Anstrengungen gegen den Klimawandel verpflichtet, sind die USA inzwischen wieder ausgetreten. Andere Länder lassen es an den zur Erreichung der Klimaziele erforderlichen Maßnahmen mangeln. Kritiker des Abkommens bemängeln, dass die Ziele zu niedrig angesetzt sind, das Abkommen keine festen Zusagen enthält usw. Aber das war wohl der Preis dafür, überhaupt zu einer Übereinkunft zu gelangen. Wie eine gerechte Verteilung der Lasten aussieht, ob die Hauptverursacher der Umweltverschmutzung auch das meiste an Reparaturarbeit leisten müssen, ob man Staaten, die gerade dabei sind, in puncto Industrialisierung aufzuholen, aus Umweltschutzgründen gleich wieder ausbremsen darf, während die anderen den Wohlstandszuwachs jahrzehntelang ungehindert genießen durften – das sind ebenfalls wieder schwer zu beantwortende Fragen, die man sich aber wohl stellen muss, wenn man der Lage, den Staaten und den Menschen gerecht werden will.
4. Schlussfolgerungen
Es gibt ganz offenbar eine Vielzahl von Faktoren, die es massiv erschweren, im internationalen Rahmen Gerechtigkeit walten zu lassen: Interessen konterkarieren das Bemühen um gerechte Lösungen. Schon die Definition dessen, was gerecht ist, kann interessengeleitet sein. Auch wenn Gerechtigkeitsvorstellungen Rechtsform angenommen haben, ist die Durchsetzung des Rechts ein Problem. Im nationalen Rahmen ist zumindest das Verhältnis von Macht und Recht geklärt, im internationalen Rahmen ist es das nicht. Ungeklärt ist ebenfalls, wem Gerechtigkeit zugutekommen soll (nur einer bestimmten Gruppe von Menschen, nur den gegenwärtigen oder auch den künftigen, nur bestimmten Staaten?). Zudem kann das Ziel Gerechtigkeit mit anderen Zielen in Konflikt geraten, so z. B. bei dem Verhältnis von Ökologie und Ökonomie oder bei der Frage des Eingriffs in staatliche Selbstbestimmung und der Achtung staatlicher Autonomie.
Das alles könnte völlig entmutigen und die Aufgabe, Gerechtigkeit auch im internationalen Rahmen anzustreben, als unlösbar betrachten lassen. Doch das ist wohl die falsche Reaktion. Eine Welt ohne Gerechtigkeit wäre eine furchtbare Welt. Es wäre eine Welt des brutalen Durchsetzungskampfes und der Vernichtung aller Werte. Insofern hat das Streben nach Gerechtigkeit einen tieferen Sinn. Gerechtigkeit ist das, was Menschen, was Staaten verbindet. Fehlende Gerechtigkeit führt zu Entzweiung, zu Hass, zu Krieg. Wir kommen, so scheint es, ohne Gerechtigkeit nicht aus. Das Problem ist, dass wir sie nicht schon haben.
Und vielleicht ist dieses Bewusstsein auch etwas, das weiterhilft. Vorschnelle Urteile darüber, was gerecht und was ungerecht ist, verbieten sich, wenn man sich klar macht, wie leicht sich auch bei einem selbst Urteil und Interesse verbünden. Der Schritt darüber hinaus ist die Prüfung der Begründung von Gerechtigkeitsvorstellungen, bei einem selbst, bei anderen Menschen, im nationalen und internationalen Bereich. Über Gerechtigkeit muss also immer debattiert werden, es müssen Argumente ausgetauscht und auf ihre Schlüssigkeit hin untersucht werden. Und wenn einem im internationalen Raum stattdessen skrupellose Machtpolitik entgegenschlägt, wird man nicht umhinkönnen, ihr auch mit Machtmitteln zu begegnen – immer in dem Bewusstsein, dass es dabei nicht bleiben kann, weil es um mehr geht als um die Selbstdurchsetzung, nämlich eben um die Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bleibt eine immerwährende Aufgabe – aber eine, deren Übernahme man nicht ablehnen kann.
Barbara Zehnpfennig war von 1999 bis zu ihrer Emeritierung 2022 Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau.