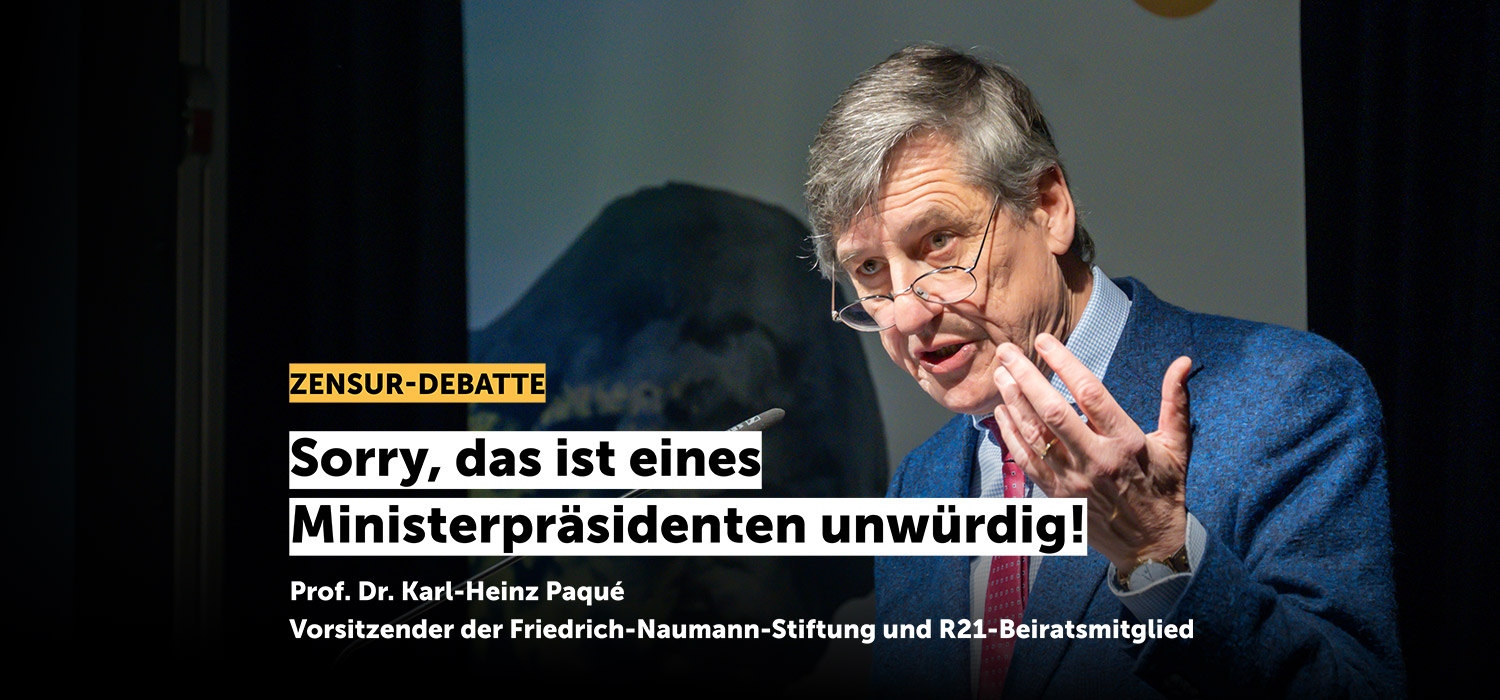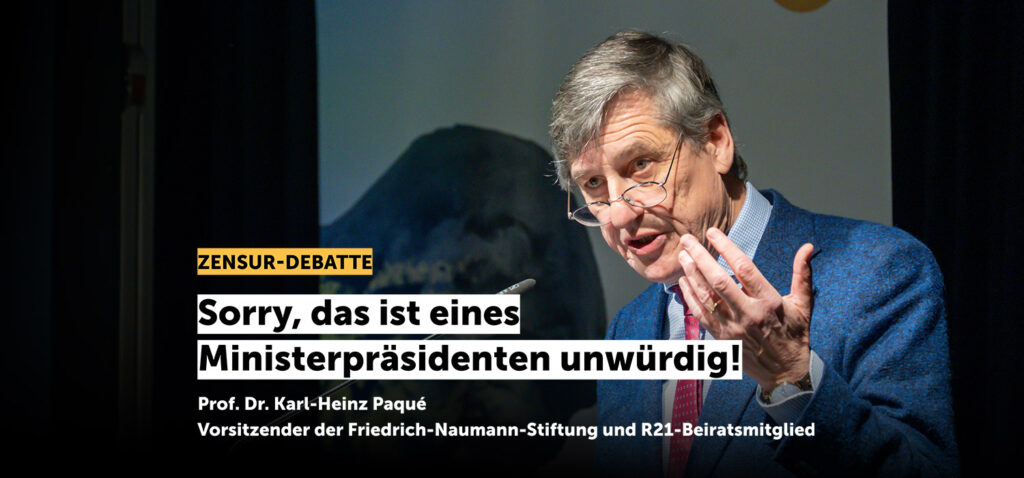Die Welt – und die Aktienmärkte – brauchten eine Weile, um zu begreifen, dass Trumps Zölle nicht reziproke Zollparität erreichen sollen, sondern den Ausgleich der Handelsdefizite der USA mit einzelnen Ländern. Bemerkenswerterweise zielen diese Zölle nur auf Ungleichgewichte im Warenhandel ab und lassen dabei den beträchtlichen Überschuss Amerikas bei Dienstleistungen außer Acht. Präsident Trump und seine engagiertesten Protektionisten Peter Navarro und Howard Lutnick wollen Einnahmen erhöhen und Industriearbeitsplätze zurückholen. „Made in America“ soll bei Stahl, Autos, Turnschuhen oder Öl wieder zur Regel werden.
Das ganze Paket basiert auf einem Konzept, mit dem viele populistische Bewegungen die hart arbeitende Mittelschicht idealisieren: Dem Produktivismus. Demnach produziert der Mittelstand die wirtschaftlichen und moralischen Güter, von denen sowohl die Eliten oben als auch die Transferbezieher unten profitieren. Zwei Formen des Produkivismus grenzen die idealisierte Mittelschicht unterschiedlich ab: Der dezentrale Produktivismus fokussiert sich auf den traditionellen Mittelstand im Handwerk, der Landwirtschaft, aber auch im Einzelhandel oder in der Gastgewerbe, der Produktivismus der schmutzigen Hände auf Industriearbeitsplätze.
Dezentraler Produktivismus: Das Jefferson’sche Ideal
Der dezentrale Produktivismus ist tief in der politischen Kultur Amerikas verwurzelt. Thomas Jefferson stellte sich Amerika als eine Nation selbstständiger Farmer vor, die der Industrialisierung skeptisch, dafür dem Freihandel offen gegenüberstehen. In einem Brief an John Adams aus dem Jahr 1812 beschrieb Jefferson jede Familie idealerweise als „Manufaktur in sich selbst“, die nur für bestimmte „feinere Güter“ auf externe industrielle Produktion angewiesen sein sollte.
In dieser Version des Produktivismus leitet sich der Wert der Arbeit aus der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeit von staatlicher und unternehmerischer Macht ab, nicht aus einer bestimmten Produktionsweise. Die People’s Party – Amerikas erste bedeutende populistische Bewegung – verkörperte dieses Ethos. Der Historiker Lawrence Goodwyn beschrieb sie als eine freiheitsliebende, basisdemokratische Bewegung, die sich dezentral vernetzte, um so der Macht der Finanzindustrie und der Eisenbahnmonopolisten etwas entgegenzustellen.
In Deutschland wurde der dezentrale Produktivismus unter anderen von den Ordoliberalen Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow vertreten. In ihren Schriften stellten beide die Bedeutung einer unabhängigen, traditionellen Mittelschicht als Gegengewicht zu einem zur Übergriffigkeit neigenden Staates heraus und warben engagiert für eine dezentralistische Marktwirtschaft mit vielen kleinen, lokal verankerten Unternehmen.
„Schmutzige Hände“- Produktivismus: Schornsteine und Staatsmacht
Im Gegensatz dazu verortet der „schmutzige Hände“-Produktivismus den Quell unseres Wohlstands in großen Fabriken, in denen es dampft, raucht und qualmt. Die dortigen Arbeiter sind meist gewerkschaftlich organisiert, die Unternehmen in großen Industrieverbänden.
Populisten wie der ehemalige Governor von Alabama George Wallace vertraten diese Version. Für ihn waren es vor allem die „Stahlarbeiter, Gummiarbeiter oder Textilarbeiter“, die im Gegensatz zu den „überausgebildeten Leuten aus dem Elfenbeinturm“ noch die echten amerikanischen Werte vertreten würden.
Der Weg von diesem Produktivismus zur merkantilistischen Denke ist kurz: Nach dieser Denke ist eine Nation stärker, wenn sie mehr produziert und weniger konsumiert. Zusammengenommen entsteht eine etwas krude Form der Arbeitswertlehre, wonach nur wirklich viel Wert hat, was auch viel Arbeit macht. Um Industrie-Arbeitsplätze zu erhalten, greifen Anhänger des schmutzigen-Hände-Produktivismus gerne zu Subventionen und Zöllen. Die so konservierten Strukturen sind allerdings meist nicht lebensfähig, sobald die staatliche Protektion ausläuft.
2. April: Die hohen Kosten der schmutzigen-Hände-Nostalgie
Das Zolldebakel vom 2. April ist das Ergebnis eines schmutzigen-Hände-Produktivismus, der sich mit MAGA-Nationalismus und einer schlichten merkantilistischen Argumentation vermengte. So emotional ansprechend das Ziel sein mag, durch Zölle Industriearbeitsplätze zu erhalten – ökonomisch ist es höchst fragwürdig.
Laut Economist ist es keineswegs offensichtlich, dass das Bedienen von Industrierobotern erfüllender ist als das Zubereiten von Cappuccinos. Daten des Bureau of Labor Statistics zeigen, dass viele Dienstleistungsberufe – bei vergleichbarem Ausbildungsniveau – den traditionellen Fertigungsberufen nicht nur in Sachen Bezahlung, sondern auch hinsichtlich Sozialleistungen, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsschutz ebenbürtig oder sogar überlegen sind.
Gleichzeitig sind die realen Kosten protektionistischer Maßnahmen zur „Rückholung von Industriearbeitsplätzen“ beträchtlich – insbesondere für traditionelle, staatsferne Mittelständler, die auf Importe oder globale Lieferketten angewiesen sind. Sie werden zum Kollateralschaden von Industrie-Nostalgie und merkantilistischem Nullsummendenken.
Die zwei Seiten des Produktivismus
Dabei benennt der Produktivismus ein reales Problem: Die traditionelle Mittelschicht ist politisch, medial und kulturell unterrepräsentiert. Doch nur ein dezentraler Produktivismus kann in einer funktionieren Wettbewerbsordnung die Repräsentationslücke verkleinern. Er stärkt lokale Autonomie und wirkt vermachteten Strukturen entgegen. Der nostalgische schmutzige-Hände-Produktivismus trägt hingegen eher zur weiteren Verflechtung von Staat und Wirtschaft bei, als ihr entgegenzuwirken.
Der wahre Prüfstein ist nicht, ob eine Tätigkeit mit Stahl, Software oder Cappuccino zu tun hat, sondern ob für sie im Markt auch ohne staatliche Intervention eine Nachfrage besteht. Und der Wert des Handels misst sich nicht daran, ob er in volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ausgeglichen ist, sondern daran, ob er freiwillig stattfindet und damit beiden Handelspartnern nützt. Nur freiwilliger Handel nutzt die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung, schafft nachhaltigen Wohlstand und begrenzt wirksam sowohl Markt- als auch Staatsmacht.
Author
-

Nils Hesse berät und unterstützt die Denkfabrik R21 in Fragen der Ordnungspolitik und der Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft. Er hat Abschlüsse in VWL, BWL, Social Science und Politikwissenschaften und an der Uni Freiburg / Abteilung für Wirtschaftspolitik promoviert. Nils Hesse hat unter anderem als Redenschreiber im Bundeswirtschaftsministerium, Referent beim BDI, Wirtschaftspolitischer Grundsatzreferent im Kanzleramt, Journalist, Economic Analyst bei der EU-Kommission, Lehrbeauftragter und Fraktionsreferent der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gearbeitet. Derzeit arbeitet er an einer Habilitationsschrift zum Thema „Ordoliberalismus und Populismus“.
Alle Beiträge ansehen